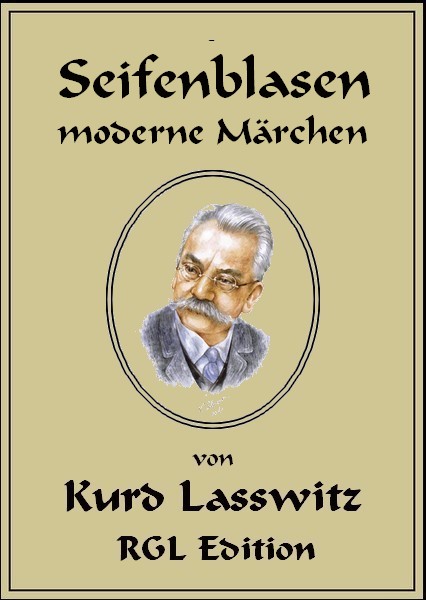
RGL e-Book Cover 2016©
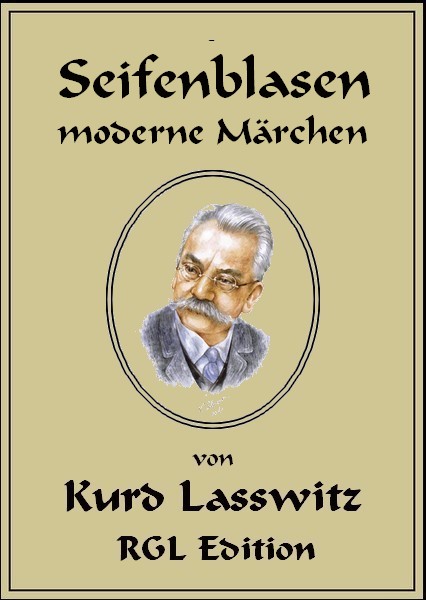
RGL e-Book Cover 2016©
Wenn Frauen jedes Vorwort überschlagen
Und Männer alles, was an Verse streift,
So darf man, hoff' ich, von dem unsern sagen,
Daß es zum höchsten Ziel der Kunst gereift.
Denn rein als Selbstzweck wird es vorgetragen,
Weil jeder gleich zu Text und Prosa greift;
Der Autor liest es ganz allein von allen —
So wird es sicher »allgemein« gefallen.
Doch ein Programm, auch wenn es niemand hört,
Soll im Prolog ästhetisch uns verpflichten.
Das schickt sich so! Und wer nicht willig schwört
Zu unsrer Fahne — nun, der mag verzichten.
Er gilt uns selbstverständlich als betört,
Begreift uns nicht und braucht uns nicht zu richten —
Vorausgesetzt, daß er zu tadeln fand,
Denn loben darf auch, wer uns nicht verstand.
Wir werden also erstlich deduzieren,
Warum die Seife wohlgefallen muß;
Wir werden dann die Kugel demonstrieren
Als Form für den berechtigten Genuß.
Und sollten wir trotzdem nicht reüssieren,
So bleibt uns keine Rettung zum Beschluß
Als aus den Grenzen wachsamer Doktrin
Ins Reich der Dichtung ohne Paß zu flieh'n.
Wollt ihr die Zeit gewissenhaft verwenden,
Studiert zuvor ein Lehrbuch der Chemie;
Denn Seifenblasen kann man erst entsenden,
Wenn Fett gebunden sich an Alkali.
Und weil sich Kunst wird anders nie vollenden
Als durch Natur und wahre Empirie,
So übt nur brav die Seifensiederei —
Dann will ich lehren, was das Schöne sei.
Ihr denkt vielleicht, schön sei der lichte Thau
Im Morgenschein am grünen Bergeshanges
Schön sei das Auge der geliebten Frau,
Die sanfte Glut, gehaucht auf ihre Wange?
Verzeiht! Was schön ist, wissen wir genau
Und wir behaupten's mit der Wahrheit Zwange:
Schön ist, was von Interesse frei sich hält,
Nicht als Begriff, doch allgemein gefällt.
Und durftet ihr so leicht, was schön ist, lernen,
(Ich hoffe doch, daß jeder es kapiert,)
Gebt acht, ob wir auch nirgend uns entfernen
Von der Erklärung, die wir acceptiert.
Der gilt uns wenig unter den Modernen,
Der nicht als Künstler theoretisiert
Und schnell für sein ästhetisches Interesse
Sich ein Organ begründet in der Presse.
Nun denn — Wer zweifelte, daß Seifenwasser
Das Wohlgefallen allgemein erregt?
Brummt dort vielleicht ein dunkler Menschenhasser,
Wenn man das Haus durchscheuert, kehrt und fegt?
Mit Unrecht schilt der zürnende Verfasser,
Wird ihm dabei ein Manuskript verlegt, —
Denn hin und wieder eingeseift zu werden
Ist schließlich doch der Dinge Los auf Erden.
Doch halt! Ist nicht Begriff die Seife nur,
Wenn zum Objekt des Denkens wir sie machten,
Statistisch als den Maßstab der Kultur
Und nicht von Interesse fern sie dachten?
Um frei zu wandeln auf der Schönheit Spur
Gilt's ohne Zweck die Seife zu betrachten,
Nicht weil sie reinigt, sondern in der Reinheit
Der bloßen Form zwecklos bezweckter Einheit!
Als Seife zwecklos, doch als Form bezweckt?
Wer wagt es, dieses Dunkel aufzuhellen?
Wohlan! Die Lösung haben wir entdeckt,
Seit uns gelungen, das Problem zu stellen.
Es wird der Stoff geläutert und gestreckt,
Und wenn sich dann die feinsten Schaumlamellen
Geschlossen zur vollkomm'nen Spannung runden,
Hat Formenzweck den Stoffzweck überwunden!
So sei als Seifen-Idealgestaltung
Die Form der Kugeln einzig uns gepriesen!
In ihr kommt alles Leben zur Entfaltung
Und alle Einheit rundet sich in diesen.
Und da wir so mit philosoph'scher Haltung
Das Recht der Seifenblasenkunst erwiesen,
Laßt endlich der Ästhetik uns entsagen
Und in der eignen Traumwelt frei behagen!
Um heut'gen Tags phantastisch uns zu zeigen
Verschmähen wir den unmodernen Tand,
Das Flügelroß der Musen zu besteigen
Zum Ritt in der Romantik altes Land.
Ganz andre Mittel sind der Neuzeit eigen
Bei der Aëronautik hohem Stand:
Ein Wink, und auf der Schaum-Montgolfière
Frei schwimmen wir im Glanz der Atmosphäre.
Ein Strohhalm und ein wenig Luft genügt —
Und Stroh und Luft gehören zu den Dingen,
Worüber stets des Dichters Kopf verfügt —
Das trübe Naß zur lichten Form zu zwingen.
Ein leichter Ball, der tausend Farben lügt,
Hebt aus der Körper schwerem Stoff die Schwingen
Und bannt die Welt in seinen bunten Spiegel —
Ein Spiel und doch ein Rätsel voller Siegel.
Im Spiele darf das Wunder sich begeben,
Denn nur die Wirklichkeit ist rauh und scharf.
So spielen wir! Und was im ernsten Leben
Mit Recht der kritische Verstand verwarf,
Die freie Laune wagt's emporzuheben,
Weil sie der eignen Thaten spotten darf.
Ein Kind der Stunde, lächelnd aufgestiegen,
Läßt sie die Seifenbälle sorglos fliegen.
Schwebt hin und schillert! — Ob das Spiel euch tauge?
Ein rauher Griff, die Farbenhülle bricht
Und in der Hand bleibt nur ein Tröpfchen Lange —
Vielleicht geriet die ganze Mischung nicht.
Doch grüßt euch liebevoll ein Freundesauge,
Vor dem ihr schimmern dürft im Sonnenlicht,
Und bleibt es nur ein Weilchen euch gewogen,
So seid ihr nicht umsonst hinausgeflogen.
»Onkel Wendel, Onkel Wendel! Sieh nur die große Seifenblase, die wunderschönen Farben! Woher nur die Farben kommen?«
So rief mein Söhnchen vom Fenster herab in den Garten, wohin es seine bunten Schaumbälle flattern ließ.
Onkel Wendel saß neben mir im Schatten der hohen Bäume, und unsere Zigarren verbesserten die reine, würzige Luft eines schönen Sommernachmittags.
»Hm«, sagte oder vielmehr brummte Onkel Wendel, zu mir gewendet, »hm, erklär's ihm doch! Hm! Bin neugierig, wie du's machen willst. Interferenzfarben an dünnen Blättchen, nicht wahr? Kenn' ich schon. Verschiedene Wellenlänge, Streifen decken sich nicht und so weiter. Wird der Junge verstehen—hm?«
»Ja«, erwiderte ich etwas verlegen, »die physikalische Erklärung kann das Kind freilich nicht verstehen—aber das ist auch gar nicht nötig. Erklärung ist ja etwas Relatives und muß sich nach dem Standpunkte des Fragenden richten; es heißt nur, die neue Tatsache in einen gewohnten Gedankengang einreihen, mit gewohnten Vorstellungen verknüpfen—und da die Formeln der mathematischen Physik noch nicht zum gewohnten Gedankengang meines Sprößlings gehören ...«
»Nicht übel, hm!« Onkel Wendel nickte. »Hast es so ziemlich getroffen. Kannst es nicht erklären, nicht mit gewohnten Vorstellungen verbinden—gibt gar keinen Anknüpfungspunkt. Das ist es eben! Erfahrung des Kindes —ganz andere Welt—, gibt Dinge, für die alle Verbindung fehlt. Ist überall so! Der Wissende muß schweigen, der Lehrer muß lügen. Oder er kommt ans Kreuz, auf den Scheiterhaufen, in die Witzblätter—je nach der Mode. Mikrogen! Mikrogen!«
Die beiden letzten Worte murmelte der Onkel nur für sich. Ich hätte sie nicht verstanden, wenn ich nicht den Namen Mikrogen schon öfter von ihm gehört hätte. Es war seine neueste Erfindung.
Onkel Wendel hatte schon viele Erfindungen gemacht. Er machte eigentlich nichts als Erfindungen. Seine Wohnung war ein vollständiges Laboratorium, halb Alchimistenwerkstatt, halb modernes physikalisches Kabinett. Es war eine besondere Gunst, wenn er jemandem gestattete einzutreten. Denn er hielt alle seine Entdeckungen geheim. Nur manchmal, wenn wir vertraulich beisammensaßen, lüftete er einen Zipfel des Schleiers, der über seinen Geheimnissen lag. Dann staunte ich über die Fülle seiner Kenntnisse, noch mehr über seine tiefe Einsicht in die wissenschaftlichen Methoden und ihre Tragweite, in die ganze Entwicklung des kulturellen Fortschritts. Aber er war nicht zu bewegen, mit seinen Ansichten hervorzutreten—und darum auch nicht mit seinen Entdeckungen, weil diese, wie er sagte, ohne seine neuen Theorien nicht zu verstehen seien. Ich habe selbst bei ihm gesehen, wie er aus anorganischen Stoffen auf künstlichem Wege das Eiweiß darstellte. Wenn ich in ihn drang, diese epochemachende Entdeckung, welche vielleicht geeignet wäre, unsere sozialen Verhältnisse gänzlich umzugestalten, bekanntzumachen oder wenigstens zu fruktifizieren, so pflegte er zu sagen: »Habe nicht Lust, mich auslachen zu lassen. Können's doch nicht verstehn. Sind doch nicht reif, kein Anknüpfungspunkt, andre Welt, andre Welt! Tausend Jahre warten! Lasse die Leute streiten, einer weiß so wenig wie der andere.«
Jetzt hatte er das Mikrogen entdeckt. Ich weiß nicht recht, war es ein Stoff oder ein Apparat; aber soviel habe ich begriffen, daß er dadurch imstande war, eine Verkleinerung sowohl der räumlichen als der zeitlichen Verhältnisse in beliebigem Maßstabe zu erzielen. Eine Verkleinerung nicht etwa bloß für das Auge, wie sie durch optische Instrumente möglich ist, sondern für alle Sinne; die ganze Bewußtseinstätigkeit wurde verändert, so, daß zwar qualitativ alle Empfindungsarten dieselben blieben, aber alle quantitativen Beziehungen verengert wurden. Er behauptete, er könne ein beliebiges Individuum und mit ihm dessen Anschauungswelt einschrumpfen lassen auf den millionsten, auf den billionsten Teil seiner Größe. Wie er das mache? Ja, dann lachte er wieder still für sich und brummte:
»Hm, nicht verstehen können—kann's euch nicht erklären—, nützt euch doch nichts. Menschen bleiben Menschen, ob groß oder klein, sehen nicht über sich hinaus. Wozu erst streiten?«
»Wie kommst du jetzt auf das Mikrogen?« fragte ich ihn.
»Sehr einfach, lieber Neffe. Das Mikrogen ist für die heutige gelehrte Welt, was die Seifenblase für deinen Jungen ist. Vielleicht ein Spielzeug, jedoch zum Verständnis fehlt jeder Anhaltspunkt. Weil aber die Gelehrten keine Kinder sind und alles zu verstehen beanspruchen, würde es einen unendlichen Streit geben, wenn ich meine Lehre auskramen wollte. Gänzlich zwecklos, weil die Entscheidung über alle heutige Einsicht hinaus liegt. Würden mich auslachen—hm—Irrenhaus ...«
»Ganz gleich«, rief ich, »die Wahrheit zu verkünden ist Pflicht, und wenn ich auch das Martyrium der Verkennung auf mich nehmen müßte! Nur auf diesem Wege sind die Fortschritte der Kultur errungen worden. Bringe deine Beweise!«
»Hm«, sagte der Onkel, »wenn aber die Beweise niemand verstehen kann? Wenn wir zwei verschiedene Sprachen reden? Dann endet der Streit damit, daß die Minorität totgeschlagen wird, physisch oder moralisch. Habe keine Lust dazu.«
»Und trotzdem«, erwiderte ich kühn, »würde ich die Wahrheit bekennen, wenn ich die Beweise für mich in der Hand habe.«
»Vor Unmündigen und Blinden—wie? Möchtest du's probieren? Ja? Sieh dir mal das Ding an.«
Onkel Wendel zog einen kleinen Apparat aus der Tasche. Ich erkannte einige Glasröhrchen in Metallfassung, mit Schrauben und einer Skala. Er hielt mir die Röhrchen unter die Nase und begann zu drehen. Ich fühlte, daß ich etwas Ungewohntes einatmete.
»Ah, wie schön die da ist!« rief mein Knabe wieder, auf eine neue Seifenblase deutend, die langsam von der Fensterbrüstung herabschwebte.
»Nun sieh dir mal die Seifenblase an«, sagte Onkel Wendel und drehte weiter.
Mir schien es, als ob sich die Seifenblase sichtlich vergrößerte. Ich kam ihr näher und näher. Das Fenster mit dem Knaben, der Tisch, vor dem wir saßen, die Bäume des Gartens entfernten sich, wurden immer undeutlicher. Nur Onkel Wendel blieb neben mir; sein Röhrchen hatte er in die Tasche gesteckt. Jetzt war unsere bisherige Umgebung verschwunden. Wie eine mattweiße, riesige Glocke dehnte sich der Himmel über uns, bis er sieh am Horizont verlor. Wir standen auf der spiegelnden Fläche eines weiten, gefrorenen Sees. Das Eis war glatt und ohne Spalten; dennoch schien es in einer leise wallenden Bewegung zu sein. Undeutliche Gestalten erhoben sich hie und da über die Fläche.
»Was geht hier vor!« rief ich erschrocken. »Wo sind wir? Trägt uns auch das Eis?«
»Auf der Seifenblase sind wir«, sagte Onkel Wendel kaltblütig. »Was du für Eis hältst, ist die Oberfläche des zähen Wasserhäutchens, welches die Blase bildet. Weißt du, wie dick diese Schicht ist, auf der wir stehen? Nach menschlichem Maß gleich dem fünftausendsten Teile eines Zentimeters; fünfhundert solcher Schichten übereinandergelegt, würden zusammen erst ein Millimeter betragen.«
Unwillkürlich zog ich einen Fuß in die Höhe, als könnte ich mich dadurch leichter machen.
»Um Himmels willen, Onkel«, rief ich, »treibe kein leichtsinniges Spiel! Sprichst du die Wahrheit?«
»Ganz gewiß. Aber fürchte nichts. Für deine jetzige Größe entspricht dieses Häutchen an Festigkeit einem Stahlpanzer von zweihundert Meter Dicke. Wir haben uns nämlich mit Hilfe des Mikrogens in allen unseren Verhältnissen im Maßstabe von eins zu hundert Millionen verkleinert. Das macht, daß die Seifenblase, welche nach menschlichen Maßen einen Umfang von vierzig Zentimetern besitzt, jetzt für uns gerade so groß ist wie der Erdball für den Menschen.«
»Und wie groß sind wir selbst?« fragte ich zweifelnd.
»Unsere Höhe beträgt den sechzigtausendsten Teil eines Millimeters. Auch mit dem schärfsten Mikroskop würde man uns nicht mehr entdecken.«
»Aber warum sehen wir nicht das Haus, den Garten, die Meinigen—die Erde überhaupt?«
»Sie sind unter unserm Horizont. Aber auch wenn die Erde für uns aufgehen wird, so wirst du doch nichts von ihr erkennen als einen matten Schein, denn alle optischen Verhältnisse sind infolge unserer Kleinheit so verändert, daß wir zwar in unserer jetzigen Umgebung völlig klar sehen, aber von unserer früheren Welt, deren physikalische Grundlagen hundertmillionenmal größer sind, gänzlich geschieden leben. Du mußt dich nun mit dem begnügen, was es auf der Seifenblase zu sehen gibt, und das ist genug.«
»Und ich wundere mich nur«, fiel ich ein, »daß wir hier überhaupt etwas sehen, daß unsere Sinne unter den veränderten Verhältnissen ebenso wirken wie früher. Wir sind ja jetzt kleiner als die Länge einer Lichtwelle; die Moleküle und Atome müssen uns jetzt ganz anders beeinflussen.«
»Hm!« Onkel Wendel lachte in seiner Art. »Was sind denn Ätherwellen und Atome? Ausgeklügelte Maßstäbe sind's, berechnet von Menschen für Menschen. Jetzt machen wir uns klein, und alle Maßstäbe werden mit uns klein. Aber was hat das mit der Empfindung zu tun? Die Empfindung ist das erste, das Gegebene; Licht, Schall und Druck bleiben unverändert für uns, denn sie sind Qualitäten. Nur die Quantitäten ändern sich, und wenn wir physikalische Messungen anstellen wollten, so würden wir die Ätherwellen auch hundertmillionenmal kleiner finden.«
Wir waren inzwischen auf der Seifenblase weitergewandert und an eine Stelle gekommen, wo durchsichtige Strahlen springbrunnenähnlich rings um uns in die Höhe schössen, als mich ein Gedanke durchzuckte, der mir vor Entsetzen das Blut in den Adern stocken ließ. Wenn die Seifenblase platzte! Wenn ich auf eines der entstehenden Wasserstäubchen gerissen wurde und Onkel Wendel mit seinem Mikrogen auf ein anderes! Wer sollte mich jemals wiederfinden? Und was sollte aus mir werden, wenn ich in meiner Kleinheit von einem sechzigtausendstel Millimeter mein Leben lang bleiben mußte? Was war ich unter den Menschen? Gulliver in Brobdignak läßt sich gar nicht damit vergleichen, denn mich konnte überhaupt niemand sehen! Meine Frau, meine Kinder! Vielleicht sogen sie mich mit dem nächsten Atemzuge in ihre Lunge, und während sie meinen unerklärlichen Verlust beweinten, vegetierte ich als unsichtbare Bakterie in ihrem Blute!
»Schnell, Onkel, nur schnell!« rief ich. »Gib uns unsere Menschengröße wieder! Die Seifenblase muß ja sofort platzen! Ein Wunder, daß sie noch hält! Wie lange sind wir denn schon hier?«
»Keine Sorge«, sagte Onkel Wendel ungerührt, »die Blase dauert noch länger, als wir hierbleiben. Unser Zeitmaß hat sich zugleich mit uns verkleinert, und was du hier für eine Minute hältst, das ist nach irdischer Zeit erst der hundertmillionste Teil davon. Wenn die Seifenblase nur zehn Erdsekunden lang in der Luft fliegt, so macht dies für unsere jetzige Konstitution ein ganzes Menschenalter aus. Die Bewohner der Seifenblase freilich leben wieder noch hunderttausendmal schneller als gegenwärtig wir.«
»Wie, du willst doch nicht behaupten, daß die Seifenblase auch Bewohner habe?«
»Natürlich hat sie Bewohner, und zwar recht kultivierte. Nur verläuft ihre Zeit ungefähr zehnbillionenmal so schnell wie die menschliche, das heißt, sie empfinden, sie leben zehnbillionenmal so rapid. Das bedeutet, drei Erdsekunden sind soviel wie eine Million Jahre auf der Seifenblase, wenn auch deren Bewohner den Begriff des Jahres in unserm Sinne nicht ausgebildet haben, weil ihre Seifenkugel keine regelmäßige und genügend schnelle Rotation besitzt. Wenn du nun bedenkst, daß diese Seifenblase, auf der wir uns befinden, vor mindestens sechs Sekunden entstand, so mußt du zugeben, daß in diesen zwei Millionen Jahren sich schön ein ganz hübsches Leben und eine angemessene Zivilisation hierselbst entwickeln konnte. Wenigstens entspricht dies meinen Erfahrungen auf anderen Seifenblasen, welche alle in ihren Produkten die Familienähnlichkeit mit der Mutter Erde nicht verleugneten.«
»Aber wo sind diese Bewohner? Ich sehe hier wohl Gegenstände, die ich für Pflanzen halten möchte, und diese halbkugelförmigen Kuppeln könnten eine Stadt vorstellen. Doch etwas Menschenähnliches kann ich nicht entdecken.«
»Sehr natürlich. Unsere Empfindungsfähigkeit, wenn sie auch hundertmillionenmal so groß geworden ist als die der Menschen, ist doch noch hunderttausendmal langsamer als die der Saponier (so wollen wir die Bewohner der Seifenblase nennen). Während wir jetzt eine Sekunde vergangen glauben, verleben sie achtundzwanzig Stunden. In diesem Verhältnisse ist hier alles Leben beschleunigt. Betrachte nur diese Gewächse.«
»Es ist richtig«, sagte ich, »ich sehe deutlich, wie hier die Bäume —denn diese korallenartigen Bildungen sollen ja wohl Bäume sein —vor unseren Augen wachsen, blühen und Früchte zeitigen. Und dort scheint ein Haus gewissermaßen aus dem Boden zu wachsen.«
»Die Saponier bauen daran. In dieser Minute, während welcher wir zuschauen, beobachten wir den Erfolg von mehr als zweimonatiger Arbeit. Die Arbeiter selbst sehen wir nicht, weil ihre Bewegungen viel zu schnell für unsere Wahrnehmungsfähigkeit verlaufen. Doch wir wollen uns bald helfen. Mittels des Mikrogens will ich unsern Zeitsinn auf das Hunderttausendfache verfeinern. Hier, rieche noch einmal. Unsere Größe bleibt dieselbe, ich habe nur die Zeitskala verstellt.«
Onkel Wendel brachte aufs neue sein Röhrchen hervor. Ich roch, und sofort fand ich mich in einer Stadt, umgeben von zahlreichen rege beschäftigten Gestalten, die eine entschiedene Menschenähnlichkeit besaßen. Nur schienen sie mir alle etwas durchsichtig, was wohl von ihrem Ursprünge aus Glyzerin und Seife herrühren mochte. Auch vernahmen wir ihre Stimmen, ohne daß ich jedoch ihre Sprache verstehen konnte. Die Pflanzen hatten ihre schnelle Veränderlichkeit verloren, wir waren jetzt in gleichen Wahrnehmungsverhältnissen zu ihnen wie die Saponier oder wie wir Menschen zu den Organismen der Erde. Was uns vorher als Springbrunnenstrahlen erschienen war, erwies sich als die Blütenstengel einer schnell wachsenden hohen Grasart.
Auch die Bewohner der Seifenblase nahmen uns jetzt wahr und umringten uns unter vielen Fragen, welche offenbar Wißbegierde verrieten.
Die Verständigung fiel sehr schwer, weil ihre Gliedmaßen, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit den Armen von Polypen besaßen, so seltsame Bewegungen ausführten, daß selbst die Gebärdensprache versagte. Indessen nahmen sie uns durchaus freundlich auf; sie hielten uns, wie wir später erfuhren, für Bewohner eines andern Teils ihres Globus, den sie noch nicht besucht hatten. Die Nahrung, welche sie uns anboten, hatte einen stark alkalischen Beigeschmack und mundete uns nicht besonders; mit der Zeit gewöhnten wir uns jedoch daran, nur empfanden wir es als sehr unangenehm, daß es keine eigentlichen Getränke, sondern immer nur breiartige Suppen gab. Es war überhaupt auf diesem Weltkörper alles auf den zähen oder gallertartigen Aggregatzustand eingerichtet, und es war bewunderswert zu sehen, wie auch unter diesen veränderten Verhältnissen die Natur oder vielmehr die weltschöpferische Kraft des Lebens durch Anpassung die zweckvollsten Einrichtungen geschaffen hatte. Die Saponier waren wirklich intelligente Wesen. Speise, Atmung, Bewegung und Ruhe, die unentbehrlichen Bedürfnisse aller lebenden Geschöpfe, gaben uns die ersten Anhaltspunkte, einzelnes aus ihrer Sprache zu verstehen und uns anzueignen.
Da man bereitwillig für unsere Bedürfnisse sorgte, und Onkel Wendel versicherte, daß unsere Abwesenheit von zu Hause einen für irdische Verhältnisse verschwindenden Zeitraum nicht übersteigen könne, so ergriff ich mit Freuden die Gelegenheit, diese neue Welt näher kennenzulernen. Ein Wechsel von Tag und Nacht fand zwar nicht statt, aber es folgten regelmäßige Ruhepausen auf die Arbeit, welche ungefähr unserer Tageseinteilung entsprachen. Wir beschäftigten uns eifrig mit der Erlernung der saponischen Sprache und versäumten nicht, die physikalischen Verhältnisse der Seifenblase sowie die sozialen Einrichtungen der Saponier genau zu studieren. Zu letzterem Zwecke reisten wir nach der Hauptstadt, wo wir dem Oberhaupte des Staates, welches den Titel »Herr der Denkenden« führt, vorgestellt wurden. Die Saponier nennen sich nämlich selbst die »Denkenden«, und das mit Recht, denn die Pflege der Wissenschaften steht bei ihnen in hohem Ansehen, und an den Streitigkeiten der Gelehrten nimmt die ganze Nation den regsten Anteil. Wir sollten darüber eine Erfahrung machen, die uns bald übel bekommen wäre.
Ober die Resultate unserer Beobachtung hatte ich sorgfältig ein Buch geführt und reiches Material angehäuft, welches ich nach meiner Rückkehr auf die Erde zu einer Kulturgeschichte der Seifenblase zu bearbeiten gedachte. Leider hatte ich einen Umstand außer acht gelassen. Bei unserer sehr plötzlich notwendig werdenden Wiedervergrößerung trug ich meine Aufzeichnungen nicht bei mir, und so geschah das Unglück, daß sie von den Wirkungen des Mikrogens ausgeschlossen wurden. Natürlich sind meine unersetzlichen Manuskripte nicht mehr zu finden; sie fliegen als unentdeckbares Stäubchen irgendwo umher und mit ihnen die Beweise meines Aufenthaltes auf der Seifenblase.
Wir mochten ungefähr zwei Jahre unter den Saponiern gelebt haben, als die Spannung zwischen den unter ihnen hauptsächlich vertretenen Lehrmeinungen einen besonders hohen Grad erreichte. Die Überlieferung der älteren Schule über die Beschaffenheit der Welt war nämlich durch einen höchst bedeutenden Naturforscher namens Glagli energisch angegriffen worden, welchem die jüngere progressistische Richtung lebhaft beifiel. Man hatte daher, wie dies in solchen Fällen üblich ist, Glagli vor den Richterstuhl der »Akademie der Denkenden« gefordert, um zu entscheiden, ob seine Ideen und Entdeckungen im Interesse des Staates und der Ordnung zu dulden seien. Die Gegner Glaglis stützten sich besonders darauf, daß die neuen Lehren den alten und unumstößlichen Grundgesetzen der »Denkenden« widersprächen. Sie verlangten daher, daß Glagli entweder seine Lehre widerrufen oder der auf die Irrlehre gesetzten Strafe verfallen solle. Namentlich befanden sie folgende drei Punkte aus der Lehre Glaglis für irrtümlich und verderblich.
Erstens: Die Welt ist inwendig hohl, mit Luft gefüllt, und ihre Rinde ist nur dreihundert Ellen dick. Dagegen wendeten sie ein: Wäre der Boden, auf welchem sich die »Denkenden« bewegen, hohl, so würde er schon längst gebrochen sein. Es stehe aber in dem Buche des alten Weltweisen Emso (das ist der saponische Aristoteles): »Die Welt muß voll sein und wird nicht platzen in Ewigkeit.«
Zweitens hatte Glagli behauptet: Die Welt besteht nur aus zwei Grundelementen, Fett und Alkali, welche die einzigen Stoffe überhaupt sind und seit Ewigkeit existieren; aus ihnen habe sich die Welt auf mechanischem Wege entwickelt, auch könnte es niemals etwas anderes geben, als was aus Fett und Alkali zusammengesetzt sei; die Luft sei eine Ausschwitzung dieser Elemente. Hiergegen erklärte man, nicht bloß Fett und Alkali, sondern auch Glyzerin und Wasser seien Elemente; dieselben könnten unmöglich von selbst in Kugelgestalt gekommen sein; namentlich aber stehe in der ältesten Urkunde der Denkenden: »Die Welt ist geblasen durch den Mund eines Riesen, welcher heißt Rudipudi.«
Drittens lehrte Glagli: Die Welt sei nicht die einzige Welt, sondern es gäbe noch unendlich viele Welten, welche alle Hohlkugeln aus Fett und Alkali seien und frei in der Luft schwebten. Auf ihnen wohnten ebenfalls denkende Wesen. Diese These wurde nicht bloß als irrtümlich, sondern als staatsgefährlich bezeichnet, indem man sagte: Gäbe es noch andere Welten, welche wir nicht kennen, so würde sie der »Herr der Denkenden« nicht beherrschen. Es steht aber im Staatsgrundgesetz: »Wenn da einer sagt, es gäbe etwas, was dem Herrn der Denkenden nicht gehorcht, den soll man in Glyzerin sieden, bis er weich wird.«
In der Versammlung erhob sich Glagli zur Verteidigung; er machte besonders geltend, daß die Lehre, die Welt sei voll, derjenigen widerspräche, daß sie geblasen sei, und er fragte, wo denn der Riese Rudibudi gestanden haben soll, wenn es keine anderen Welten gäbe. Die Akademiker der alten Schule hatten trotz ihrer Gelehrsamkeit einen harten Stand gegen diese Gründe, und Glagli hätte seine beiden ersten Thesen durchgesetzt, wenn nicht die dritte ihn verdächtig gemacht hätte. Aber die politische Anrüchigkeit derselben war zu offenbar, und selbst Glaglis Freunde wagten nicht, für ihn in dieser Hinsicht einzutreten, weil die Behauptung, daß es noch andere Welten gäbe, als eine reichsfeindliche und antinationale betrachtet wurde. Da nun Glagli durchaus nicht widerrufen wollte, so neigte sich die Majorität der Akademie gegen ihn, und schon schleppten seine eifrigsten Gegner Kessel mit Glyzerin herbei, um ihn zu sieden, bis er weich sei.
Als ich all das grundlose Gerede für und wider anhören mußte und doch sicher war, daß ich mich auf einer Seifenblase befand, die mein Söhnchen vor etwa sechs Sekunden aus dem Gartenfenster meiner Wohnung mittels eines Strohhalms geblasen hatte, und als ich sah, daß es in diesem Streite doppelt falscher Meinungen einem ehrlich nachdenkenden Wesen ans Leben gehen sollte —denn das Weichsieden ist für einen Saponier immerhin lebensgefährlich —, so konnte ich mich nicht länger zurückhalten, sondern sprang auf und bat ums Wort.
»Begehe keinen Unsinn«, flüsterte Onkel Wendel, sich an mich drängend. »Redest dich ins Unglück! Verstehen's ja doch nicht! Wirst ja sehen! Sei still!«
Aber ich ließ mich nicht stören und begann: »Meine Herren Denkenden! Gestatten Sie mir einige Bemerkungen, da ich tatsächlich in der Lage bin, über Ursprung und Beschaffenheit Ihrer Welt Auskunft zu geben.«
Hier entstand ein allgemeines Murren: »Was? Wie? Ihrer Welt? Haben Sie vielleicht eine andere? Hört! Hört! Der Wilde, der Barbar! Er weiß, wie die Welt entstanden ist.«
»Wie die Welt entstanden ist«, fuhr ich mit erhobener Stimme fort, »kann niemand wissen, weder Sie noch ich. Denn die ›Denkenden‹ sind so gut wie wir beide nur ein winziges Pünkchen des unendlichen Geistes, der sich in unendlichen Gestalten verkörpert. Aber wie das verschwindende Stückchen Welt, auf dem wir stehen, entstanden ist, das kann ich Ihnen sagen. Ihre Welt ist in der Tat hohl und mit Luft gefüllt, und ihre Schale ist nicht dicker, als Herr Glagli angibt. Sie wird allerdings einmal platzen, aber darüber können noch Millionen Ihrer Jahre vergehen.« (Lautes Bravo der Glaglianer.) »Es ist auch richtig, daß es noch viele bewohnte Welten gibt, nur sind es nicht lauter Hohlkugeln, sondern viel millionenmal größere Steinmassen, bewohnt von Wesen wie ich. Und Fett und Alkali sind weder die einzigen, noch sind sie überhaupt Elemente, sondern es sind komplizierte Stoffe, die nur zufällig für diese Ihre kleine Seifenblasenwelt eine Rolle spielen.«
»Seifenblasenwelt?« Ein Sturm des Unwillens erhob sich von allen Seiten.
»Ja«, rief ich mutig, ohne auf Onkel Wendels Zerren und Zupfen zu achten, »ja, Ihre Welt ist weiter nichts als eine Seifenblase, die der Mund meines kleinen Söhnchens mittels eines Strohhalmes geblasen hat und die der Finger eines Kindes im nächsten Augenblicke zerdrücken kann. Freilich ist, gegen diese Welt gehalten, mein Kind ein Riese ...«
»Unerhört! Blasphemie! Wahnsinn!« schallte es durcheinander, und Tintenfässer flogen um meinen Kopf. »Er ist verrückt! Die Welt soll eine Seifenblase sein? Sein Sohn soll sie geblasen haben! Er gibt sich als Vater des Weltschöpfers aus! Steinigt ihn! Siedet ihn!«
»Der Wahrheit die Ehre!« schrie ich. »Beide Parteien haben unrecht. Die Welt hat mein Sohn nicht geschaffen, er hat nur diese Kugel geblasen, innerhalb der Welt, nach den Gesetzen, die uns allen übergeordnet sind. Er weiß nichts von euch, und ihr könnt nichts wissen von unserer Welt. Ich bin ein Mensch, ich bin hundertmillionenmal so groß und zehnbillionenmal so alt wie ihr! Laßt Glagli los! Was streitet ihr um Dinge, die ihr nicht entscheiden könnt?«
»Nieder mit Glagli! Nieder mit dem ›Menschen‹! Wir werden ja sehen, ob du die Welt mit dem kleinen Finger zerdrücken kannst! Ruf doch dein Söhnchen!« So raste es um mich her, während man Glagli und mich nach dem Bottich mit siedendem Glyzerin hinzerrte.
Sengende Glut strömte mir entgegen. Vergebens setzte ich mich zur Wehr. »Hinein mit ihm!« schrie die Menge. »Wir werden ja sehen, wer zuerst platzt!«
Heiße Dämpfe umhüllten, ein brennender Schmerz durchzuckte mich, und —
Ich saß neben Onkel Wendel am Gartentisch. Die Seifenblase schwebte noch an derselben Stelle.
»Was war das?« fragte ich erstaunt und erschüttert.
»Eine hunderttausendstel Sekunde! Auf der Erde hat sich noch nichts verändert. Hab' noch rechtzeitig meine Skala verschoben, hätten dich sonst in Glyzerin gesotten. Hm? Soll ich noch die Entdeckung des Mikrogens veröffentlichen? Wie? Meinst jetzt, daß sie dir's glauben werden? Erklär's ihnen doch!«
Onkel Wendel lachte, und die Seifenblase zerplatzte. Mein Söhnchen blies eine neue.
Ein frischer Ost milderte die Kraft der Sonne. Ihr klarer Schein lag über dem langgestreckten Tale, strahlte zurück von den blanken Eisenschienen und dem hellen Kies der kleinen Bahnhofsstation und glänzte auf der Wolke von Dampf und Staub, in welcher der Schnellzug donnernd sich entfernte.
Richard erinnerte sich kaum der letzten Minuten, wie er Lenoren und ihrer Mutter gegenüber Platz genommen. Sein guter Freund Viktor, mit dem wohlgenährten Gesichte und der goldenen Brille des praktischen Arztes, hatte auf dem Perron gestanden und als Schluß des Handgepäcks Lenoren einen prächtigen Rosenstrauß überreicht. Wie warm waren Blick und Worte, als sie ihm dankte: »Auf Wiedersehen!“
»In acht Tagen,« hatte Viktor gerufen, »eine lange Zeit! Zu ärgerlich, daß ich mich nicht eher hier frei machen kann. Unterhalte die Damen, Richard, und träume nicht! Du sitzest vorwärts und auf der Windseite, aber Ihr Dichter legt ja wohl darauf kein Gewicht.«
Durch die Bewegung des Zuges war das Gesräch abgeschnitten worden. Noch einmal winkte Lenore mit dem Rosenstrauße hinaus und fragte dann ihre Mutter, ob sie auch bequem sitze. Sie sei sehr müde, erklärte die stattliche Dame und lehnte sich behaglich in die Ecke.
Richard sah schweigend auf sein schönes Gegenüber. Der Wiederschein eines breiten rotseidenen Hutrandes hüllte ihre anmutigen Züge in ein reizvolles Dämmerlicht, aus welchem zwei dunkle Augen verführerisch hervorleuchteten. Er kannte diese Augen von Jugend auf. Die Träume des Jünglings waren von ihnen durchleuchtet, und ihr Glanz hatte den Mann aus der Ferne zurückgezogen nach der Heimat. Nach langer Trennung war er jetzt in ihrem Schimmer seit Wochen gewandelt im leichten Verkehr sommerlicher Erholung, unterm Waldesschatten und frischen Lufthauch der Berge. Hatte er wiedergefunden, was er hoffte erwarten zu dürfen? Die Knospe war erblüht; hauchte sie auch den süßbelebenden Duft der Rose? Wie anders hatte er sich die Heimfahrt gedacht! Sollte fremd und unverstanden bleiben, was ihm das innerste Herz bewegte, und gab es keine Regung in dieser schönen Hülle, die den Flug seiner Seele zu begleiten vermochte? Ein schmerzliches Lächeln zuckte um seinen Mund.
Der Zug rollte hinaus in die Ebene, und Lenore spielte zerstreut mit dem Griff ihres Schirmes. Ein Sonnenstrahl fiel schräg von der andern Seite des Wagens herein, und tausend kleine Stäubchen tanzten zitternd im goldigen Scheine. Da blitzt es hervor wie ein helles Pünktchen, auf und ab wiegt es sich und nun ist's hindurchgeschwebt durch den schmalen Lichtstreif und verschwunden im Dunkel. Woher kommt ihr, kleine Gestalten, wohin geht ihr, und was sucht ihr im weiten Raume? Was treibt euch in ewiger Unruhe zu spielen, zu irren, zu flüchten? Im Lichte schwebt ihr, aber nur auf dem dunklen Hintergrunde des Schattens habt ihr Leben und Erscheinung! Ach nur das Unerreichliche lockt die Sonnenkinder, das ewig Verlorene und das nie Geborene. — Strebend nach dem Strahlenglanze des Glücks flattert ihr an der Nachtgrenze des Leides, Boten der Sehnsucht schweift ihr umher und findet nimmer!
»Welch abscheulicher Staub,« sagte Lenore und fuhr mit ihrem Sonnenschirm in den Lichtstreifen, daß die Stäubchen wild durcheinanderwirbelten.
»Nun haben Sie den kleinen Wesen ihren schönen Tanz gestört,« sagte Richard. »Thut es Ihnen nicht leid?«
Lenore sah ihn verwundert an. »Sie sind seltsam,« erwiderte sie. »Sie sagen das so ernsthaft, daß man fast einen Schreck bekommt, als könnte man auch dem Staube unrecht thun. Ich wundere mich nur, daß Sie mir diese interessante Gesellschaft nicht förmlich vorgestellt haben: Herr von Sonnenstaub — Fräulein Lenore. Ich hätte Lust zu einem kleinen Luftwalzer.« Sie lachte übermütig und schlug noch einmal in den Lichtstreifen.
»Sagen Sie den Herrschaften, daß sie mir sehr gleichgiltig sind. Staub ist Staub und sollte garnicht geduldet werden.«
»Warum nicht?« fragte Richard ruhig. »Glauben Sie nicht, daß jedes von diesen kleinen Stäubchen seine Geschichte hat, jedes vielleicht seinen eigenen Charakter und eine Aufgabe im großen Wirbeltanz, den man Welt nennt?«
»Immer besser!« erwiderte Lenore spottend. »Nächstens behaupten Sie, daß auch das Sandkörnchen dort in der Cigarrenasche auf dem Fensterbrett einen Roman erlebt habe.«
»Ganz gewiß hat es ihn erlebt.«
»Das heißt, der Wind hat es irgend einmal hereingeblasen und wird es wieder hinausblasen!«
»Aber wie wollen Sie wissen, woher und wohin? Das Körnchen und jenes Stäubchen, das dort wieder im Sonnenlicht aufblinkt, vielleicht haben sie sich seit Jahrtausenden nicht gesehen und begrüßen sich gerade jetzt mit zärtlichen Blicken? Vielleicht sind sie selbst berufen, in unser Leben einzugreifen und seinen Gang zu entscheiden?«
»Sie werden unheimlich, Richard. Es ist nicht behaglich, sich überall unter mysteriösen Gestalten und Gewalten zu sehen. Verzeihen Sie mir, das sind Phantastereien, die ich nicht liebe. Ich sehe die Sachen, wie sie sind, und dann weiß ich, was ich zu thun habe. Aber natürlich — Sie sind ja ein Dichter, warum sollen Sie nicht die Sprache des Staubes verstehen? Ich begnüge mich damit, ihn abzuwischen.« Und sie blies leise über den Griff ihres Sonnenschirms hinweg.
»Wer nicht mit den Dingen lebt, die ihn umringen, wer sich nicht Eins fühlt mit dem geheimen Weben, welches das große All in ewigem Zusammenhange durchflutet, dem wird nur zu leicht auch jedes freiere Streben der Menschen leer und nutzlos erscheinen, soweit es ihm nicht die eigenen Zwecke fördert —«
»Um Gottes Willen, keine Predigt — ich glaube, ich habe Sie schon oft darum gebeten. Lieber erzählen Sie, was Sie an dem Stäubchen oder Körnchen so Absonderliches finden.«
»Ich denke mir,« begann Richard nach kurzem Besinnen, »weit im sonnigen Süden auf hohem Bergesrücken einen kahlen Felsblock. Ein zartes Glimmerblättchen schmiegt sich an ein Quarzkörnchen, das neben ihm einstmals aus gährendem Mutterschoß der Erde erstarrt war. Weithin schauten sie über die Lande und hinab in die schattigen Haine von Lorbeer, Myrte und Oliven, in welchen die weißen Tempelsäulen ragten und Menschen schritten in Festgewändern. Das Glimmerblättchen sehnte sich hinaus in die Freiheit. Wenn die Musen ihren Reigen führten auf ihrem heiligen Berge und es ihrem Sange lauschte vom Leide der Götter und der Menschen, da wäre es gern hinabgeschwebt, mit ihnen die Herzen zu rühren und sie nach sich zu ziehen im Streben nach dem Unerreichlichen, nach dem Unerfüllbaren, welches das Ewige ist. Aber aus alter Gewohnheit haftete es an dem Quarzkörnchen, und das Quarzkörnchen sagte: »Kümmere Dich nicht um solchen Unsinn! Sind wir nicht hier auf einer anständigen Höhe! Was geht uns der Staub im Thale an?« Das Glimmerblättchen mochte es nicht länger ertragen, so reden zu hören, und es wünschte erst recht in die Ferne zu schweifen. Es dehnte und bog sich in der Sonnenglut, Regen und Schnee scheuerten an ihm, und eines Tages kam der Sturm und riß es ab; als ein ganz winziges, kaum sichtbares Splitterchen flog es in die Höhe, aber es war sich genug; denn nun war es ein Sonnenstäubchen geworden.«
»Nun wird es hoffentlich einmal etwas erleben,« sagte Lenore.
»Lange flatterte es umher und freute sich der Wonne des Schwebens, dann sank es ermüdet auf den Sand. Da kam es daher wie Donner, Hufe der Rosse stampften die Rennbahn und Staub wirbelte auf um die klingenden Räder der Wagen, die um das Ziel rasselten. Ein linder West trug das Stäubchen mit Tausenden seiner Genossen in die nahen Hallen des Heiligtums, und im schrägen Sonnenstrahl tanzte es zum erstenmal den Reigen der Sonnenkinder.
Ein trauerndes Weib lehnte an einer Marmorsäule und blickte mit thränenfeuchten Augen in den dämmernden Lichtstreifen, der sich durch die Halle zog.
»Weilst Du unter ihnen Chloris?« flüsterte sie fragend. »Seele meiner geliebten Kleinen, die sie zu früh hinatmete in den Äther, spielst Du mit den Geschwistern in Helios' Strahlenreiche? Habt sie lieb, flatternde Seelen, die ihr umherschwebt als Sonnenstäubchen; wie ich sie liebte, so hütet sie zärtlich! Und ihr Windgötter, hohe Gewalten, die ihr die Seelen der Geschiedenen bewegt im Luftkreise, ehrwürdige Tritopatoren, die ihr sie zurückführt, damit sie geboren werden zu neuem Erdenleben, schützt sie, die Seele meiner Chloris, gebt ihr dereinst eine glücklichere Mutter als mich, die Einsame!«
Sie verhüllte ihr Antlitz mit dem Schleier und schritt die Stufen hinab, weinend.
Das Sonnenstäubchen aber merkte, daß ihm die geheime Macht gegeben war, die Seelen der Menschen emporzuziehen und zu erfüllen mit Sehnsucht nach dem, was ihnen lieb war, und heiligen Schmerz um das Verlorene in die Herzen zu streuen. Stolz hob es sich im Lichte, aber die Sonne ging hinter die Berge, sein kurzer Glanz erlosch, und es stieß an eines der Weihgefäße, die im Tempel standen. Zum Unglück geriet es in eine Randverzierung, darin noch ein Tröpfchen Wein im Eintrocknen begriffen war, und dort blieb es kleben.«
»Das kommt davon,« sagte Lenore und schnappte das Schloß ihres Reisetäschchens zu, womit sie gespielt hatte. Richard sah sie enttäuscht an. Wie schön war sie und wie gleichgiltig ruhten diese Züge!
»Das kommt davon,« wiederholte er leise.
»Ihr Stäubchen mag sich übrigens trösten,« begann sie wieder, »an Wein und Gold sind schon Bessere kleben geblieben.«
Als Richard nichts erwiderte, fragte sie: »Nun — und klebt es noch immer?«
»Es wurde ganz eingesargt,« antwortete Richard. »In's stille Heiligtum drang der Lärm der Waffen, Römerkrieger schleppten die Gefäße heraus, die goldene Schale ward zu einem Klumpen zusammengeschlagen und eingeschmolzen, und das Glimmerblättchen geriet zum Unglück in irgend ein Goldstück. In tiefem Schlummer lag es im goldenen Sarge und mit ihm schlief die Sehnsucht. Denn nur im Lichte leben die Sonnenstäubchen und irren flatternd umher nach unbekanntem Ziele. Das Gold rollte seinen Weg durch der Menschen Hände ein Jahrtausend lang, gierig streckten sich die Finger danach aus, nach dem Sonnenstäubchen fragte niemand.
Richard schwieg und Lenore unterdrückte ein leichtes Gähnen. »Die römischen Goldstücke sind etwas plump,« sagte sie. »Ich habe eine Brosche aus einem solchen — Himmel, wir haben doch die kleine Brosche nicht vergessen?«
»Sie ist im Koffer,« antwortete die Mutter mit halbgeöffneten Augen und legte das Taschentuch unter ihre Wange, um besser weiter zu schlummern.
Richard sah stumm zum Fenster hinaus. Ich wußte es, dachte er schmerzlich bewegt. Was kümmert sie das Stäubchen, das der Sturm vom Gipfel des Parnassos riß, um es unverstanden zu begraben?
»Was wurde nun aus dem Goldstück?« fragte Lenore. »Das möchte ich doch wissen, vielleicht wird es jetzt lustiger.«
Ein hartes Wort schwebte Richard auf der Zunge, aber er überwand sich und fuhr nach kurzer Pause fort:
»Grünes Weinlaub umrankt die enge Fensteröffnung einer Klosterzelle. Frühlingshauch trägt die Düfte des blühenden Flieders herein, und ein schmaler Sonnenstreifen gleitet vorwitzig bis auf das weiße Pergament, auf welchem ein prächtiger Anfangsbuchstabe im Entstehen begriffen ist. Ein Mönch sitzt davor und glättet an dem Goldgrund, den er sorgfältig aufgetragen; seine Gedanken sind ganz bei dem kleinen Bilde, welches die heilige Geschichte zieren soll. Da verschiebt er ein wenig das Pergament, die Sonne trifft auf das Gold und das glättende Elfenbein, und aus dem Golde löst sich das kleine schimmernde Glimmerstäubchen. Der Mönch weiß nicht, daß er es sieht, aber wie es im Lichte tanzt, muß sein Auge dem Sonnenstreifen folgen, bis dieser im grünen Weinlaub sich verliert, und nun — — Er sieht nicht mehr die Zelle und das Fenster, die stille Laube erblickt er im Ritterhofe des Vaters, wo er vor Jahren gestanden, und schaut in zwei milde blaue Augen und ein Antlitz, von Liebe leuchtend, das sich ihm zuneigt. Mit beiden Händen hält er Mathildens Hand umfaßt, und ihre Worte vernimmt er wieder, wie er zum letzten mal sie hörte: »Leb wohl, mein Freund!« Verlieren soll er sein Glück und seine Hoffnung und weiß doch, daß sie ihn liebt, heiß und innig, und elend ist im Scheiden, wie er. Warum, o warums »Es muß sein, mein Freund. Lieben ist süß, und Gehorsam ist bitter; aber gehorchen werd' ich und folgen dem Gebote des Vaters, und ihm, den er gewählt. Ich liebe dich, doch ich gehe in die Pflicht. Murre du nicht gegen Gottes Ordnung — o könnt' ich helfen dir und deinem Leid, einen Trank dir geben zu vergessen — um mich sorge nicht, ich bin stark und kräftig und will leben, und du bist ein Mann.« — Wie einen letzten Kuß fühlt' er's brennen auf seinen Lippen — in der Ferne sah er einen Reiterzug verschwinden — es war ihm, als hörte er nächtliches Weinen — in tiefem Schmerz stöhnte er auf. —
Da verlosch der Sonnenstrahl am Fenster, in welchem das Stäubchen tanzte, er aber stürzte nieder vor dem Crucifix und griff nach der Geißel, die daneben hing, und die Mönche in den Nachbarzellen sagten: »Der Bruder Kunibert treibt es heftig.«
Lenore zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht,« sagte sie, »was Sie davon haben, immer solch traurige Geschichten zu erzählen.«
»Ich hatte Ihnen ja gesagt, es ist die Gabe des Sonnenstäubchens, den Menschen das Innerste aufzurühren in der Sehnsucht um das Unerreichbare. Kämpfen nicht Pflicht und Liebe überall ihren unlöslichen Streit, und ist's nicht etwas Großes um das Können, die Bilder des Lebens aufzurollen der durchschauerten Seele?«
»Das mag wohl über meinen Horizont gehen,» sagte sie. »Ich finde es sehr unbequem und ungemütlich, immer an Unangenehmes zu erinnern; so etwas muß man vergessen —«
»Ganz richtig — man muß vergessen.« —
»Der Klosterbruder kann Einem höchstens leid thun. Da ist Mathilde jedenfalls vernünftiger. Sie ist hoffentlich glücklich geworden?«
»Wir hoffen es,« antwortete Richard trocken. »Sie war ja eine »starke Natur«, der die Sonnenstäubchen nichts anhaben. Sie bekam sieben Söhne und sieben Töchter und alle haben sich glücklich verheiratet.«
»Sie sind abscheulich,« rief Lenore. Dann öffnete sie ihr Täschchen und holte eine elegante Bonbonniere hervor, die sie ihm darbot.
»Es soll Gnade für Recht ergehen,« sagte sie. »Hier haben Sie etwas Herzstärkendes. Nun seien Sie aber vernünftig. Die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren mag ja ganz hübsch sein für — Sonnenstäubchen, für unser Einen ziehe ich etwas Solideres vor. Nehmen Sie diese Chokolade — Sie danken? Jedenfalls aber erzählen Sie noch etwas Nettes vom Quarzkörnchen — und nun nicht mehr sentimental.«
Richard verneigte sich ironisch. »Auf die Gefahr, Ihnen noch mehr zu mißfallen. Das Quarzkörnchen langweilte sich und dachte, wenn das Glimmerchen ein Sonnenstäubchen geworden ist, warum soll ich mich nicht amüsieren? Ich bin eigentlich ein Kristall; ich habe eine elegante Figur und eine blanke Oberfläche. Man wird sich freuen, mich in der Gesellschaft zu begrüßen. Man wird mir huldigen. Warum soll ich den Menschen nicht einen Gefallen thun?
Ein Jahrtausend und noch eins war vergangen, seitdem das Glimmerblättchen entflogen, da sprengte ein frischer Nachtfrost das Körnchen los und es glitt über die Schneewand zu Thale. Bald rollte es im Wasser vom Bach zum Fluß und vom Fluß zum Meere; eine Woge schleuderte es auf den Strand, die Sonne trocknete schnell seine Seiten, und es fand sich zu seinem Vergnügen glatter und schöner wie je. — Wenn mich das Glimmerchen jetzt sehen könnte, dachte es, das würde sich gleich wieder in mich verlieben. Ein Wirbelwind erfaßte das Körnchen und warf es auf die Landstraße.
»Könnt' ich mich nur erst den Menschen bemerklich machen,« sprach es bei sich, »wie würden sie mich bewundern!«
Endlich kam ein Maultiertreiber vorüber, der trat auf das Körnchen mit seinen nackten Füßen und es bohrte sich vergnüglich in seine Sohle. Nicht lange, so fand der Treiber das ungemütlich; er begann zu fluchen. »Aha,« dachte das Körnchen, »er fängt schon an mich zu bemerken; das sind die ersten Seufzer des Herzens.« Und es bohrte recht kräftig weiter mit seinen Kanten und Ecken. »Verwünschter Weg!« sagte der Treiber, griff nach seiner Decke, die auf dem Maultier lag, und rieb damit seinen Fuß. Dann warf er die Decke wieder auf das Tier. Das Körnchen haftete an der Decke und rutschte zwischen die Säcke, die das Maultier trug. Sie waren mit Korinthen gefüllt und wurden zu Schiffe gebracht. Das Körnchen war ziemlich zufrieden mit seinem ersten Erfolge, es kroch durch eine dünne Stelle des Gewebes und bettete sich recht bequem zwischen den kleinen Rosinen. Es dachte sogar nach: was der Mensch auf der Straße sagte, war nicht übel, es schien ein Gedicht, das man auf mich machte; man könnte es in Musik setzen. Doch darauf lege ich keinen Wert. Ich finde es sehr rücksichtsvoll, daß man mich so mit Süßigkeiten umgeben hat. Und das war nur eine oberflächliche Bekanntschaft! Wie werde ich erst wirken, wenn man mich näher kennen lernt.«
Sollten Sie dem Sandkörnchen nicht unrecht thun?« unterbrach Lenore die Erzählung. »Warum muß es so prätentiös sein?«
»Es war eben so — es war ein Sandkörnchen und dachte wie ein Sandkörnchen, und als solches war es sich selbst die Hauptsache.«
»Sie müssen's ja wissen.«
»Leider — je länger ich dem Sandkörnchen folge, um so sicherer weiß ich, daß ich nicht irre — es war kein Sonnenstäubchen —«
»Und wollte auch keines werden,« sagte Lenore nachlässig.
Richard warf einen langen Blick auf sie und schwieg.
»Ich möchte nur wissen,« hub Lenore plötzlich wieder an, »wozu nach Ihrer Idee so ein Sandkörnchen eigentlich gut ist. Ich denke, es hat alles seine »ewige Aufgabe« — oder wie Sie das Ding nennen.«
»Gewiß, und auch das Körnchen erfüllt sie nach seiner Art; und wenn es nur wäre —«
»Und wenn es nur wäre —?«
»Um Illusionen zu zerstören —«
»Ah — lassen Sie hören!«
»Wie Sie befehlen.«
»Eines Tages wurde es wieder hell um das Körnchen. Es fand sich nebst einigen Korinthen zwischen den Fingern eines Kindes, das eben von jenen naschen wollte, als die älteste Schwester in das Zimmer trat und ihm auf das Händchen klopfte. Das Kind ließ die Rosinen los und begann zu weinen; das Körnchen war bis auf den Tisch geflogen.
»Man reißt sich um mich,« sprach es, »man gönnt mich niemand.«
Das junge Mädchen, welches das Kind zurechtgewiesen, trat an den Tisch und sagte: »Da hat der Bruder wieder Streusand ausgeschüttet,« und — eins — zwei — drei — hatte sie das Quarzkörnchen mit dem Streusand in die Büchse gefegt. Die vom Streusand moquierten sich über seine Toilette; es sei nicht einmal blau gefärbt, meinten sie. Das Quarzkörnchen aber bemerkte hochmütig, auf dem Parnaß sei Weiß Mode, und darauf käme es doch wohl an. Indessen hatte sich das junge Mädchen an den Tisch gesetzt und einige Worte auf einen Zettel geworfen.
»Lieber Werther. Erkundigen Sie sich doch bei dem Kaufmann, wann er wieder frische Orangen bekommt. Nächsten Mittwoch erwarten wir Albert. Auf Wiedersehen! Lotte.«
Einen Augenblick wurde sie nachdenklich, dann trällerte sie eine Française und tanzte einmal auf und ab durch die Stube. Sie faltete den Brief und gab ihn dem Boten.
Ein ernster Mann stand in seinem Zimmer. Durch das Fenster zog die Sonne des Sommerabends ihre Lichtstreifen, und unser Glimmerblättchen schwebte darin. Er preßte die Hände zusammen, und sein starrer Blick folgte den Strahlen. Er sah die großen schwarzen Augen jenes Mädchens vor sich — diese Augen — und diese Lieblichkeit und Anmut — niemand kann sie beschreiben, außer Einem, der hat's gekonnt, und alle Welt hat's gelesen — —
»Wie soll das endens« rief er seufzend. »Ich will sie nicht wiedersehen und lebe doch nur in der Hoffnung, daß ich sie sehen werde. Meine Arme streck' ich aus, eine Welt möchte ich umarmen und in's Leere fass' ich, das mit trügerischen Hoffnungen erfüllt ein Traum mir vorgegaukelt. Und ich wußte es, daß es ein Traum sein müsse — und doch! O Lotte, Lotte!«
Mit diesem Seufzer griff er nach dem Zettel, der geöffnet neben ihm lag, er riß ihn mit sehnsüchtiger Glut an seine Lippen und drückte einen heißen Kuß auf den Namen der Geliebten.
»Endlich!« sagte das Körnchen und sprang ihm zwischen die Zähne, daß sie knirschten. Und mit dem Tuche, das eben seine Thränen benetzt, wischte er sich den Streusand von den Lippen —«
»Nun?« fragte Lenore, da Richard schwieg. »Und die Moral der langen Geschichte, wenn sie etwa zu Ende sein sollte?«
»Ich fürchte, sie ist es,« sagte Richard und sah ihr mit tiefem Ernst in das Gesicht. »Oder halten Sie es nicht für ein gutes Ende, wenn man die Lippen zum Kusse der Sehnsucht öffnet und den Mund voll Sand bekommt? Als das Sonnenstäubchen auf dem Boden von Werthers Zimmer das Quarzkörnchen wiedersah, mit welchem es auf dem Parnaß zusammen gewohnt, da flatterte es sehnsüchtig zu ihm nieder und wollte sich an seine Seite schmiegen. Aber das Körnchen sagte: »Entschuldigen Sie, ich bin jetzt erwachsen und in der Welt herumgekommen, und das schickt sich nicht.« Und das Stäubchen erzählte ihm, daß es die angeborene Göttergabe erprobt habe und nun hoffen dürfe, im Reigen der Sonnenkinder zu schweben, ein Führer den Menschen zu lichten Höhen, wo das Leid der Erde sich löst im Schimmer der ewigen Schönheit. Da sagte das Körnchen: »Ich mache mir nichts aus dem Herumfliegen, ich bin eigentlich ein Krystall und gehöre in eine gediegene Fassung.« Und wieder sprach das Stäubchen: »Du schöner, kalter Krystall, trotz alledem — wenn Du mir nur wiederspiegeln wolltest einen Strahl meiner Sehnsucht, nur einen Funken innigen Mitgefühls, und verstehen wolltest, was ich Dir sage —«
Mit unterdrücktem Schmerzensruf fuhr Richard mit der Hand an sein Auge, das er nicht zu öffnen vermochte. Er bedeckte sein Gesicht und versuchte das thränende Lid zu trocknen.
»Was ist Ihnen?« fragte Lenore.
»Das Sandkörnchen,« sagte er und wandte sich ab.
Es hatte lange genug am Fensterbrette gespielt; jetzt hielt es seine Zeit für gekommen, es sprang in die Höhe und vom Winddrucke des Schnellzuges getrieben flog es in das Auge des Dichters. Lenore lachte laut auf und rief: »Das ist die Strafe, warum haben Sie das Quarzkörnchen schlecht gemacht! Sie sehen furchtbar komisch aus, wenn Sie so zwinkern!«
Richard lehnte sich schweigend zurück. Es gelang ihm, nach einiger Zeit mit dem Zipfel seines Tuchs das Körnchen zu entfernen, aber das entzündete Auge schmerzte ihn, und er hielt es geschlossen. Der Zug rasselte über Weichen, Häuserreihen tauchten auf, man hielt am Bahnhof. Lenore blickte hinaus. »Ach,« rief sie, »da ist mein Bruder und Cousin Benno.« Mit leichtem Sprunge war sie aus dem Wagen.
»Schneidiges Wetter heut' — kolossaler Staub,« schnarrte Cousin Benno, ihr Tuch und Tasche abnehmend.
Lenore wandte sich zurück, sie nickte Richard zu und sagte zum Abschied:
»Und was hat Ihnen das Körnchen noch verraten?«
»Das Ende«, erwiderte Richard kalt.
Tristan da Cunha, 28. Dezember 1881
Verehrter Freund! Fernab vom Wege des Weltverkehrs, im südlichen Teil des Atlantischen Ozeans, schreibe ich Ihnen heute auf einsamer Berginsel, wo ich der siebenundachtzigste Bewohner bin und der achtundachtzigste wohl sobald nicht ankommen wird, und ich täte vielleicht besser, hierzubleiben und ein beschauliches Einsiedlerleben zu führen, als aus der Gemeinschaft seliger Götter, die ich vor wenigen Tagen verlassen, wieder in das Barbarentum Europas zurückzukehren, das meine Berichte verlachen wird. Ach, hätten Sie einmal den Fuß in das Seelenschiff gesetzt, einmal vom ambrosischen Tisch gegessen und, wie ich, wenigstens einen Blick in das intelligible Paradies geworfen! Sie würden gleich mir zwischen stolzer Wonne und unstillbarer Sehnsucht nach dem Unerreichbaren schwanken. Doch Ihnen mit Ihrem zeitlichen Bewußtsein muß man ja in historischer Ordnung erzählen, wenn Sie hören sollen.
Der Einladung Lord Lyttons folgend, hatte ich, wie Sie wissen, die Archäologie für einige Monate beurlaubt und mich ganz der Reiselaune unseres generösen Freundes anvertraut. Wir schwammen auf seiner Dampfjacht »Moonshine« unter der Obhut des wackeren Kapitäns Clynch bei prächtigem Wetter in dem einsamen, selten besuchten südlichen Teile des Atlantik. Am 11. Dezember 1881, mittags um 12 Uhr, als wir unter 28° 34' westlicher Länge (von Greenwich) und 39° 56' südlicher Breite uns gerade zum Frühstück setzen wollten, wurde uns die Nähe von Eisbergen gemeldet. Bald tauchten nicht nur einzelne helle Massen, sondern eine meilenlange hohe weißglänzende Mauer vor unseren Blicken auf – das seltsame Phänomen mußte untersucht werden. Während sich die »Moonshine« in sicherer Entfernung hielt, ruderten vier kräftige Matrosen den Arzt des Schiffes, Mr. Gilwald, und mich nach den glitzernden Kolossen hin. Je näher wir dem Gebirge kamen, um so mehr bemerkten wir zu unserem Erstaunen, daß wir es gar nicht mit schwimmenden Eismassen, sondern mit dem steilen Felsenstrande einer Insel zu tun hatten. Ein tief eingeschnittener Fjord eröffnete unserem Boote eine Einfahrt, und es gelang uns, einen passenden Platz zum Anlegen zu finden. Und nun überzeugten wir uns zu unserer Überraschung, daß das vermeintliche Eis nichts anderes war als eine Felsenwand von riesigen Kalkspat-Kristallen, die allerdings aus der Ferne mit ihren Reflexen im Sonnenlichte Eisbergen täuschend ähnlich sah. Hierin lag jedenfalls der Grund, weshalb an dieser Meeresstelle auf der Karte zwar die Beobachtung von Eisbergen, aber nichts von einer Insel verzeichnet war. Ich begann die Felswand, deren Höhe etwa hundert Meter betragen mochte, hinaufzuklettern, da die vorspringenden Kristalle das Unternehmen nicht sehr schwierig machten.
Kaum hatte ich den oberen Rand erreicht und einen Blick hinübergeworfen, als ich wie verzaubert stehenblieb, unfähig vor Erstaunen und Bewunderung, mich zu rühren. Die Felswand fiel, einem Riesenwall ähnlich, zuerst steil ab, dann aber ging sie in ein hügeliges Gelände über, das, im blühenden Grün eines reichen Pflanzenschmuckes prangend, sich allmählich zu einer stillen Meeresbucht hinabsenkte. Hinter der Bucht erhoben sich neue Hügel, auf denen zwischen dem Grün der Lorbeer- und Olivenbäume die glänzend weißen Häuser und Paläste einer ausgedehnten Stadt aufstiegen, alles überragt von jenem Wunderbau der Akropolis, wie er einst die Stadt der Pallas Athene geschmückt hatte. Auf diesem entzükkenden landschaftlichen Hintergrunde spielte sich das regste Leben ab; auf dem Meere Fahrzeuge von seltsamer Gesatalt und Menschen, die über das Wasser zu huschen schienen, am Ufer eine zahlreiche Menge in lebhafter Bewegung, aber in Trachten und Formen, wie ich sie noch nie beobachtet. Nach den ersten Augenblicken regungslosen Hinstarrens suchte ich mich zu besinnen. Meinen Gefährten zuzurufen, getraute ich mich nicht, weil ich noch gar nicht an die Wirklichkeit des Gesehenen glaubte. Wie sollte diese bunte Welt, die einerseits entschieden an das griechische Altertum mahnte, andererseits aber wieder einen unbeschreiblichen, mit nichts vergleichbaren Eindruck des Märchenhaften machte, wie sollte diese Welt in die Öde des Atlantischen Ozeans kommen? Während ich, solcher Frage nachhängend, auf das seltsame Treiben zu meinen Füßen starrte, mochte ich wohl langsam auf dem Felsenwall fortgegangen sein, denn ich befand mich plötzlich vor einer zwar steilen, jedoch gangbaren Treppe, welche von der Höhe nach den Hügeln hinabführte. Jetzt begann ich doch zu zweifeln, ob ich mich ohne meine Gefährten in dieses unbekannte Reich wagen sollte, aber ehe ich noch mit mir einig wurde, tauchte ein Einwohner des Landes vor mir auf, der mich durch eine Handbewegung einlud, die Stufen hinabzusteigen. Dieser Aufforderung müßte ich Folge leisten – warum, das hätte ich nicht angeben können, aber die Einladung war zwingend wie der Wink einer Gottheit. Ich kann auch das Gefühl, das ich hatte, als ich gegen meine kurz vorher gehegte Absicht nun unbedingt und doch willig dem Unbekannten nachgab, mit nichts anderem vergleichen als mit der Stimme des Gewissens, das uns zu einer Handlung treibt ohne Wahl, es mag unsere Reflexion sagen, was sie will.
Der Bewohner des Landes, der einen leichten Mantel von einem goldglänzenden Stoffe über einem dicht anliegenden Untergewand trug, war von kleiner Statur, aber edler Haltung, eine Waffe konnte ich an ihm nicht bemerken; stolzen Ganges schritt er voran, während ich, gleichwie im Traume, machtlos ihm nach wandelte. Als wir an das Ufer der Meeresbucht gelangt waren, wendete er sich nach mir um (daß ich ihm gefolgt war, schien er mit absoluter Sicherheit zu wissen, denn er hatte sich während des zehn Minuten langen Weges nicht um mich bekümmert) und richtete eine Frage an mich. Die Sprache klang mir im ersten Augenblicke fremd, und ich hätte ihn vielleicht nicht verstanden, wenn nicht der hellenische Gesamtcharakter unserer Umgebung plötzlich den Gedanken in mir hätte aufleuchten lassen: Das ist Griechisch. Und als er seine Frage wiederholte, verstand ich sie auch, nur die ungewohnte Aussprache hatte mich stutzig gemacht. Er fragte mich, aus welchem Lande ich stamme und wie ich auf diese Insel gekommen sei, auch, ob ich wüßte, welche Stadt vor meinen Augen läge. Es schien mir, daß er wohl keine Antwort auf seine Fragen erwartete, sondern sie nur gestellt hatte, um sich von meinem Barbarentum zu überzeugen; denn als ich nach bestem Vermögen in klassischem Griechisch, freilich in ihm offenbar befremdlicher, aber doch verständlicher Aussprache Antwort gab, nahmen seine Mienen den Ausdruck freudigen Erstaunens an.
Er wurde plötzlich freundlich, reichte mir die Hand und sagte: »Willkommen in Apoikis, wer du auch seist; die Sprache der Hellenen bewahrt dir die Freiheit.«
Darauf nahm er vom Uferrande ein paar eigentümlich geformte Schuhe, die er mir reichte, während er ein gleiches Paar an seinen Füßen befestigte und damit aufs Wasser hinaustrat, als sei es festes Land. Ich stand natürlich höchst verdutzt da, unwissend, was ich beginnen sollte, etwa wie ein Feuerländer, dem man ein Opernglas reicht mit der Bitte, sich zu bedienen.
Der Apoikier lächelte und erklärte mir den Gebrauch der An- thydors, wie er die Schuhe nannte. Ich muß gestehen, daß ich ihn nicht ganz verstand, und ich kam mir immer mehr barbarisch diesem zivilisierten Hellenen gegenüber vor. Doch ersah ich so viel, daß die Sohlen, welche aus Metallstreifen zusammengesetzt waren, bei der Berührung mit dem Wasser dasselbe unter lebhaftem Aufbrausen so stark zersetzten, daß ein Einsinken unmöglich wurde. Ich faßte Mut, legte die Anthydors an und bewegte mich, von meinem Führer gestützt, zu Fuß über das Wasser, nicht ohne Bangen und Beschämung ob meiner Unkenntnis.
Ach, mein Stolz auf die europäische Kultur des neunzehnten Jahrhunderts sollte bald noch, tief er, ganz tief sinken. Ich sah jetzt, daß gleich uns viele andere über das Wasser gemütlich fortschritten, ich sah aber zugleich in ihren Händen Instrumente und rings um mich, auf dem Wasser, an den Ufern und an den Häusern Vorrichtungen aller Art; die mir gänzlich fremd waren. Ein Wilder, der eine unserer europäischen Hauptstädte betritt, kann vor allen Erfindungen der Neuzeit nicht dümmer stehen als ich vor den Kunstwerken der Apoikis.
Mein Führer bog aus einer Straße auf einen weiten Platz ein, als plötzlich aus dem uns umgebenden Gewühl von Menschen ein Mann, in ähnlicher Kleidung wie mein Begleiter, hervorstürzte und mir ungestüm um den Hals fiel. »Ehbert«, rief er auf deutsch, »wie kommst du nach Apoikis?«
Mein Führer trat nicht ohne Ehrerbietung vor dem Herankommenden zurück, während ich mich kurze Zeit besinnen mußte, wen ich vor mir habe. Denn das ungewohnte Kostüm befremdete mich. Dann erkannte ich zu meiner freudigsten Überraschung – nun raten Sie – unseren lieben Studienfreund Philandros, mit dem wir im Sommer achtzehnhundertzweiundsiebzig so herzerhebende Stunden in Heidelberg verlebten.
Jetzt war ich geborgen. Philandros erklärte sich zu meinem Gastfreunde – er ist hier einie höchst angesehene Persönlichkeit – und führte mich in sein Haus. Meine stürmischen Fragen beantwortete unser Freund mit seinem stillen, olympischen Lächeln, das Sie an ihm kennen. »Mit der Zeit«, sagte er, »sollst du erfahren, soviel du vermagst; nur halte dich maßvoll, willst du bestehen. Wir sind nicht wie ihr an die sinnliche Welt der Erscheinung gebunden – doch ich merke, daß du augenblicklich von einem phänomenalen Hunger gequält wirst.«
Er stellte mich seiner Gattin vor, einer graziösen, in Violett und Gold gekleideten Dame, die ich in dem Verdacht habe, daß sie bei meinem Anblicke das Lachen nur mit Mühe unterdrückte. In der Tat mochte mein Erstaunen über meine Umgebung bewirken, daß ich noch einfältiger aussah, als ich bin. Sie führte mich indes durch einen freundlichen Wink in ein weites Gemach, das als Speisekammer, Küche und Eßzimmer zugleich diente.
»Bei uns gibt es keine Bedienung«, sagte sie, »jeder bereitet seine Nahrung selbst.«
Eine zweite Handbewegung wies mich auf die Vorräte an den Wänden hin, die ich nicht kannte, auf die Geräte, deren Gebrauch ich nicht verstand – ich zückte die Achseln, und Frau Lissara lächelte nun wirklich, nur ein klein wenig, aber ich sah es doch.
Philandros nahm einige Früchte und Fleischstücke, legte sie in eine Schale und goß eine Flüssigkeit darüber, die er Diapetton nannte, und die Berührung mit derselben vollbrachte in einer halben Minute die Wirkung eines trefflichen Bratofens. Vor mir stand ein garniertes Filet, dessen Genuß mir nicht nur vorzüglich mundete, sondern auch meine Seele in eine erhöhte Stimmung versetzte, mich von jeder Müdigkeit befreite und mir die Lust erweckte, einige der schwierigsten philosophischen Probleme zu lösen, wie man etwa bei uns zum Nachtisch Nüsse knackt.
Frau Lissara fragte mich, was die europäischen Damen für Ansichten über die Identität des ethischen und logischen Noumenons hätten und ob meine Frau an die Transzendenz oder die Immanenz des Gefühles glaube; und sie schlug die Hände über dem Kopfe zusammen, als ich ihr sagte, daß bei uns weder Ethik noch Logik in der Mädchenerziehung eine Rolle spielten.
»Auch nicht im Leben?« fragte sie.
Ihr Gatte ersparte mir die Verlegenheit der Antwort, indem er sich bereit erklärte, mir einige Aufhellung über die Verhältnisse von Apoikis zu geben. Was ich von seinen Ausführungen verstand, kann ich Ihnen nur ganz kurz skizzieren, soweit es überhaupt im Rahmen unserer Begriffe möglich ist.
Nach der Hinrichtung des Sokrates (399 vor Christi Geburt) verließ bekanntlich eine Anzahl seiner persönlichen Freunde, Gesinnungsgenossen und Schüler Athen. Gleich ihrem Meister erkannten sie, daß, nachdem der naive Glaube an die Unerschütterlichkeit der Volkssitte einmal gestört war, nicht das Zurückgehen auf das Alte, sondern nur die Erneuerung der Sitte von innen heraus zu helfen vermöge, daß aus dem Eingehen in das Bewußtsein des einzelnen und die Berechtigung der freien persönlichen Oberzeugung der Fortschritt von engherziger nationaler Starrheit zu edlem Menschentum geschehen müsse. In der Absicht, an noch unbesiedelter Küste, sei es in Spanien oder in Afrika, ein selbständiges Staatswesen zu gründen, welches, nach den Grundsätzen ihrer Erkenntnis verwaltet, sich vollständig frei entwickeln sollte, rüstete ein begütertes Brüderpaar, Chairephon und Chairekrates, von Megara aus, wohin sie sich, wie bekanntlich auch Platon, zunächst begeben hatten, eine Anzahl von Schiffen, die mit allem versehen wurden, was zur Gründung einer Kolonie gehörte. Jedoch sollte diese Ansiedlung sich möglichst unabhängig stellen und nur auf ihre eigene Kraft bauen. Ein eigentümliches Geschick wollte es, daß hier in der Tat die Pflanzstätte eines neuen Menschentums gelegt wurde, denn nachdem die Expedition die Reede von Megara verlassen, hat kein Mensch auf dem Erdenrund mehr eine Kunde von ihr erhalten; die Ausgewanderten selbst und ihre Nachkommen sind von jedem Verkehr und Einflüsse anderer Menschen und Völker abgeschnitten gewesen. Ich bin der erste, dem es gestattet ist, Kunde von jenen erhabenen Wesen nach Europa zu bringen, auf das sie mitleidig herabsehen.
Durch Stürme über die Säulen des Herkules hinausgetrieben, wurde die Expedition nach wochenlangen Gefahren bis an jene Felseninsel verschlagen, wo heute Apoikis steht. Hier fand sie Rettung. Der Fjord, in welchen auch unser Boot eingefahren war, windet sich weiterhin rückwärts und bildet das versteckte Binnenmeer, an dessen blühenden Ufern die Stadt Apoikis gegründet wurde. Das Land im Innern der Insel, sobald man die hohen Kalkspatmauern, die sie umgeben, überstiegen hatte, erwies sich als außerordentlich fruchtbar, das Klima milde und angenehm. Eine Bevölkerung von 7000 bis 8000 Seelen findet hier reichliche Nahrung, bei sehr geringer Arbeit. Eine größere Zahl von Einwohnern aber hat Apoikis niemals erreicht. Denn, wie mein Gastfreund sagte, das Glück eines Volkes besteht nicht in der möglichst großen Menge von einzelnen Zentren des Bewußtseins, sondern in der intensiven und gleichmäßigen Konzentration des Bewußtseins in jedem einzelnen Individuum.
Als ich ihn fragte, ob denn Apoikis nie an Übervölkerung leiden könne, da lächelte er und sprach: »Das kann ich dir schwer erklären. Wenn du die ganze Entwicklung unseres Kulturzustandes kenntest und die Tiefe unserer sittlichen Weltauffassung zu begreifen vermöchtest, dann würdest du einsehen, daß deine Frage zu jenen unberechtigten gehört, wie zum Beispiel, warum die Welt existiert, ob die Seele im Gehirn sitzt, ob die Tugend blau oder grün ist.«
»Erzähle nur unsere Geschichte weiter«, warf Frau Lissara ein.
»Als wir hierherkamen«, fuhr Philandros fort, »Schüler des Sokrates und Freunde des Platon, mit den Versen des Sophokles auf den Lippen und vor den Augen die Erinnerung an die Bilder des Phidias, im Herzen die Lehren des weisesten der Menschen, als wir hier ein sorgenloses Leben fanden, da bildeten wir eine kleine, aber glückliche Gemeinde philosophischer Seelen, und frei von jeder Nötigung, äußeren Gefahren entgegenzutreten, richteten wir alle Kraft auf die harmonische Ausgestaltung unseres inneren Lebens, Vertiefung des Denkens, Erziehung des Willens, maßvollen Genuß heiterer Sinnlichkeit. Zwei volle Jahrtausende verflossen, ohne daß ein Segel am Horizonte von Apoikis aufgetaucht wäre. In dieser Zeit haben wir uns unter Bedingungen, wie sie die menschenerfüllte Erde keinem Volke bieten kann, hier einer ungestörten, fortschreitenden Entwicklung erfreut. Was wir indessen erreichten, das könnt ihr nie und nimmer gewinnen, auch wenn eure Kultur in gleichem Maße, wie in dem letzten Jahrhundert, noch ein paar Jahrtausende emporstiege, denn ihr steht auf ganz anderen historischen Grundlagen als wir. Hunderte von Millionen wollen glücklich werden; dazu müßt ihr erst das Leben in mühseligem Kampfe erstreiten und dann in hundert Millionen Herzen das Gefühl maßvoller Bescheidung wecken. Das letztere könnt ihr vielleicht erreichen durch eine Religion, welche die Gemüter fortreißt. Aber leben müßt ihr doch. Und wie ihr gestellt seid, so kann die Linderung des äußeren Elendes auch nur erreicht werden durch äußere Arbeit, und darum geht alle eure Kultur nur auf Machtentwicklung der Menschheit. Sie muß darauf gehen, weil ihr das Leben nicht anders zu bezwingen vermögt. Die unsere aber verachtet und kann verachten die ungemessene Höhe, auf welche der Mensch durch Bezwingung der äußeren Kräfte der Natur gelangen kann. Denn sie hat erreicht die Tiefe, in welcher das Bewußtsein die Welt der Erfahrungen gestaltet und in welcher ihr alles andere von Selbst zufällt. Ihr seht nur das Zifferblatt der großen Weltenuhr und studiert den Gang der Zeiger; wir aber blicken in das Räderwerk und auf die treibende Feder, die wir selbst sind, und verstehen das Werk zu rücken. Euch trifft damit kein Vorwurf, ihr konntet nicht anders vorwärts schreiten, denn wo ihr es versuchtet/die Welt zu verachten und das Glück aus dem Innern zu gewinnen, da riß euch immer die hungernde Masse in den Zwang der Wirklichkeit, ehe ihr mit dem Bewußtsein der Gesamtheit in das Idealreich zu dringen vermochtet. Ihr konntet die äußere Macht nicht entbehren. Um sie zu gewinnen, mußtet ihr die Natur, die ihr verachten wolltet, wieder in eure Rechnung aufnehmen; ihr mußtet beobachten und sammeln, und nur durch Erfahrung könnt ihr die Kenntnis gewinnen, die euch mächtig macht. Und darin müßt ihr fortfahren, ihr habt kein anderes Mittel, denn euer Denken ist nicht anders fähig, die Welt zu erkennen. Sie ist euch nur zugänglich in Raum und Zeit und Notwendigkeit, und so müßt ihr gehorchen.
Wir aber bedurften zwei Jahrtausende lang nichts von der Natur, als was sie uns von selbst schenkte. Hier gab es keine darbende und unwissende Menge, keine habgierige und übermütige Gesellschaft, keine Herren und Sklaven, sondern nur eine bescheidene Anzahl gleichmäßig harmonisch durchgebildeter, sich selbst beschränkender Menschen. Wir bedurften keiner Teilung der Arbeit und keiner Fachkenntnisse, wir begnügten uns mit dem, was jeder verstehen konnte. Und so kamen wir auf einem ganz anderen Wege als ihr zur Kultur, die ihr bei uns erblickt, und zu Erfindungen und Bequemlichkeiten, die ihr nicht kennt. Jetzt freilich seht ihr hier Prachtbauten und tausenderlei Verfeinerungen, aber jeder macht nur freiwillig, was er gerade kann und will, und wir sind jetzt so weit in der Kultur des Bewußtseins, daß jeder den Gesamtzusammenhang und sich selbst begreift, daß Pflicht und Wunsch in des Apoikiers Seele nicht mehr getrennt bestehen. Wir sind nicht Sklaven der Sitte, wie die Naturvölker, nicht Herren der äußeren Natur, wie die gesitteten Nationen Europas, wir sind nur Herren von uns selbst, Herren unseres Willens, Herren des Bewußtseins überhaupt, und darum sind wir frei. Uns stört keine Sorge um darbende Völker noch um eigennützige Tyrannen, wir haben keine Gesetze, denn jeder trägt das Gesetz in sich selbst. Wir haben keine Naturwissenschaft und keine Industrie in eurem Sinne, wir brauchen der Natur keine Geheimnisse abzulauschen und ihre Kräfte nicht in unseren Dienst zu zwingen. Die Entwicklung unseres Geistes, frei von dem Druck der europäischen Millionen, ging einen anderen Weg. Bei uns folgte auf Platon kein Aristoteles, keine Scholastik, kein Dogmatismus, so brauchten wir keinen Galilei, keinen Newton, keinen Darwin. Wir hatten keine Römerherrschaft, keine Völkerwanderung, kein Feudalsystem, so brauchten wir keine Revolution. Zu der Zeit, da Achaja römische Provinz wurde, da lehrte man bei uns, was euch Kant und Schiller offenbarten. Als die christlichen Märtyrer in den Gärten Neros brannten, da emanzipierte sich unser Denken von den Schranken der Sinnlichkeit und lernte seine Bedingungen im Absoluten kennen. Als in euren Klosterschulen die spärlichen Reste der Neuplatoniker studiert wurden, da hatte man bei uns die Metaphysik als empirische Wissenschaft begründet. Und während eure Metaphysiker sich luftige Wolkenbauten im unbeschränkten Reich der Träume errichteten, da hatten wir die inneren Wesensbedingungen des Bewußtseins erfaßt und das Geheimnis der Schöpferkraft uns angeeignet. Was ihr nun messend und wägend und rechnend an Entdeckungen und Erfindungen der Natur abringt, das schaffen wir, nachdem sich unser Verstand aus seinen Fesseln befreit und in Intuitivkraft gewandelt hat, aus unserem eigenen Selbst in freier Wahl. In unserer Welt besteht kein Gegensatz von Zwang und Freiheit. Wollen, Sollen und Können sind nicht mehr getrennt. Und das haben wir errungen durch die alleinige Pflege des wollenden, fühlenden und denkenden Bewußtseins. Ihr konntet es nicht, denn ihr mußtet Völker ernähren und Kriege führen.
In den äußeren Formen haben wir die Überlieferungen unserer Vorfahren festgehalten, soweit sie uns passend erschienen; schönere haben wir bei euch nirgends gefunden. Seit den letzten beiden Jahrhunderten, in denen, wenn auch selten, sich hie und da Schiffe in unseren Gewässern zeigten, haben wir uns auch um die Geschichte der übrigen Menschheit gekümmert. Wir senden alle zehn Jahre einen Erwählten nach Europa, die Zeitverhältnisse zu studieren. Ich war der letzte, der drüben war, und dabei lernten wir uns kennen. Wir verschweigen die Existenz unseres Staates, denn wir würden nicht verstanden werden und wollen nicht gestört sein.«
»Und fürchtet ihr nicht«, fragte ich, »daß Europäer euch entdecken, daß sie eure kleine Insel in Besitz nehmen und eure Freiheit unterdrücken?«
Mein Freund lächelte wieder. »Ich sehe«, sagte er, »du hast unser Wesen noch immer nicht begriffen. Frage dich doch, konntest du dem Winke des Apoikiers widerstehen, der dich zur Stadt führte? So wenig, als der Ehrliche das Unrecht zu wollen vermag. Deine Gefährten haben wir aufgegriffen, das Schiff selbst vorläufig weggenommen, um zum Vergnügen der Einwohner, welche die Stadt nicht verlassen, ihnen die fremden Barbaren zu zeigen. Wir werden euch wieder freigeben, ihr mögt nach Europa zurückkehren. Wir werden wollen, daß deinen Gefährten jede Erinnerung an dieses Land verschwindet; keiner wird imstande sein zu erzählen, daß er unsere Insel gesehen. Du allein magst eine Ausnahme machen. Du bist nicht Gefangener, sondern Gastfreund. Dich soll nichts binden; aber ich sage dir im voraus, daß dir niemand glauben wird. Aber auch dies möge sein: Laß die Kriegsflotte Englands vor unserer Insel auffahren, laß die Armeen Europas auf unseren Kalkspatwällen stehen – wir werden wollen, und kraft des Zusammenhanges alles Bewußtseins im Absoluten werden die Kommandierenden keinen anderen Befehl auszusprechen vermögen als den des Rückzuges.«
Ich mochte wohl ein sehr dummes Gesicht zu diesen Worten machen, denn mein Freund fuhr fort: »Ich sehe wohl, du kannst das Gesagte nicht fassen. Es ist dies ebenso, als wolltest du einem Indianerstamm klarmachen, daß er nie die weißen Männer aus Amerika vertreiben könne, weil die moralische Macht der Zivilisation die Besetzung jenes Erdteils unumgänglich erzwingt. Du kannst ihn nur überzeugen durch die physische Macht, indem du auf die Zahl der Kanonen und Gewehre hinweist. Du bist uns gegenüber in dem unzureichenden Fassungsvermögen des Indianers, so will ich auch deine Sprache reden. Wenige Minuten genügen, um unsere Insel mit einem Strome freien Äthers zu umziehen. Kein Körper kann diesen Strom durchdringen, in Atome aufgelöst, wird er fortgewirbelt werden. Granate und Panzerschiff verschwinden in ihm wie der Strohhalm in der Flamme.«
Ich schwieg. Das Mahl war zu Ende. Mein Freund führte mich durch die Stadt. Was ich staunend sah und erlebte, hoffe ich Ihnen mündlich zu erzählen, wie die Fahrt auf dem Seelenschiff, die psychische Schaukel, das Begriffsspiel und zahlloses andere. Im Hafen sah ich das große submarine Eilschiff, welches alle zehn Jahre unter der Oberfläche des Wassers nach Europa fährt. Die treibende Kraft ist auch hier die chemische Zersetzung des Wassers, diese selbst aber wird durch Ätherströme bewirkt; der nähere Mechanismus ist mir nicht bekannt. Zu Fahrten in der Nähe der Insel werden dreireihige Ruderboote gebraucht, die genau nach dem Muster der athenischen Trieren gebaut sind. Man betreibt diese Ruderfahrten als einen Sport. Dann führte mich mein Freund in das Haus, in welchem meine gefangenen Gefährten untergebracht waren. Man hatte es europäisch eingerichtet, aber die eine Seite offengelassen; dort standen die Apoikier in dichten Scharen und amüsierten sich über unsere Leute, wie wir uns über die Feuerländer im zoologischen Garten amüsiert hatten. Und ebenso verblüfft und verständnislos wie jene Wilden waren hier die Europäer. Lord Lytton las in einer alten Nummer des ›Standard‹, Kapitän Clynch trank Grog, Dr. Gilwald mikroskopierte ein hier gefangenes, unbekanntes Insekt. Ein Apoikier warf ihm ein kleines Rohr zu. Gilwald hielt es vor das Auge und an das Ohr, und da er nichts damit anzufangen wußte, warf er es fort unter dem Gelächter der Apoikier. Es war ein Noumenalrohr, das, auf den Nacken gelegt, die Raumvorstellung aufhebt und das intelligible All-Eins empfinden läßt.
Die Abschiedsstunde nahte. Lord Lytton wollte nach seiner Entlassung seine Reise nach dem südlichen Eismeer fortsetzen, ich aber bat, meine schnelle Rückreise nach Europa zu ermöglichen. Man lud mich ein, eine Triere zu besteigen, schlank und schön, wie sie schmucker kein Nauarch in des Perikles Zeit aus dem Piräus geführt hat. Sie hieß der ›Odysseus‹ und trug das Bild des Dulders als Parasemeion am Vorderteil, in lebensvoller Schönheit in Holz geschnitzt. So mochte der verschlagene Mann auf der meerumflossenen Ogygia, dem Eilande der Kalypso, gesessen sein, wenn er, die Augen mit der Hand beschattend, sehnsüchtig über das Meer hinausblickte und die unnahbare Ferne suchte. Und wie die Phäaken den Odyseeus an Ithakas Strand, so setzten mich die Apoikier schlafend auf Tristan da Cuhhas Küste aus und legten ihre Gastgeschenke neben mich: einen goldenen Syllogismusbecher mit Urteilswürfeln und die am Feuer der Götterinsel versengten Flügel meiner Psyche. Als ich erwachte, standen zwei nach Tran duftende Walfischjäger vor mir und versetzten mich durch einen Schluck aus der Rumflasche in die Welt der Sinne zurück, in welcher Sie wehmütig grüßt Ihr
R. Ehbert
Wir hatten uns nach dem Abendessen um den runden Tisch in der gemütlichen Ecke gesetzt, und der Professor Alander bot mir seine Zigarren an, während unsere Frauen ihre Handarbeiten auswickelten.
»Und was würden Sie wählen?« sagte er, das Gespräch fortsetzend, zu meiner Frau, »die Tarnkappe oder den Mantel des Doktor Faust oder den unerschöpflichen Beutel Fortunats oder den Apfel vom Baum des Lebens oder –«
»Den Mantel natürlich, den Mantel«, rief meine Frau. »Dann könnte man doch einmal sich satt reisen –«
»Und zu den Mahlzeiten wieder zu Hause sein«, fiel Alanders junge Frau lächelnd ein. »Das wäre ja ganz nach deinem Geschmack, Georg.«
»Still!« drohte Alander. »Du nimmst dir doch die Tarnkappe – überall dabeisein und unsichtbar zuschauen, das ist so etwas für unsere Frauen. Und Sie« – wendete er sich zu mir –, »als Hypochonder, mit dem gefährlichen Druck bald rechts und bald links, bekommen den heilsamen Apfel, da bleibt für mich das große Portemonnaie, und das ist mir gerade recht.«
»Ihre Aufzählung von Zauber-Requisiten war sehr unvollständig«, entgegnete ich. »Mit diesen beschränkten Qualitäten bin ich nicht zufrieden. Wenn ich einmal in den Hexenschatz greifen könnte, so wählte ich irgendein Mittel, wodurch mir jeder Wunsch erfüllt würde –«
»Um Himmels willen, was würden Sie da für Unfug anrichten«, unterbrach mich Frau Alander und rückte ein Stück zur Seite; »dann sitze ich nicht mehr neben Ihnen –«
»Dann würde ich mir's eben wünschen müssen«, sagte ich und hob ihr das herabgefallene Zwirnknäuel auf. »Und das Knäuel –«
»Ließen Sie natürlich liegen –«
»Und wärst der unglücklichste Mensch der Welt, dem jede Laune erfüllt wird und der keine Wünsche mehr hat«, bemerkte meine Frau.
»Das sehe ich nicht ein. Denn erstens könnte ich ja jede etwaige Torheit wiedergutmachen, und zweitens –« »Könnten Sie sich ja vorher den nötigen Verstand wünschen«, meinte Alander trocken.
»Erlauben Sie«, sagte ich. »Ich meine das Ding nicht so, daß jeder flüchtige Gedanke mir gleich zur Tat werden sollte; nein, ich würde mir einen Apparat wählen, der erst nach einer gewissen Überlegung benützt werden kann, der mir etwa einen gewaltigen, aber doch nicht allmächtigen Geist dienstbar machte – dadurch schon wäre eine wohltätige Einschränkung gegeben –, ich will einmal sagen. Aladins Wunderlampe.«
»Und dann?« fragte unsere liebenswürdige Wirtin.
»Dann stellte ich Ihnen meinen Geist zur Verfügung.«
»Sie meinen hoffentlich den Geist der Lampe. Gut, so wollen wir uns einen hübsehen Wunsch überlegen.«
Alander lächelte still und nahm von seinem Schreibtisch einen Gegenstand, den er auf den Tisch stellte. Es war eine kleine antike Lampe von Kupfer mit seltsamen Verzierungen.
»Die Lampe ist da«, sagte er, »ich bitte um den Geist.«
»Was haben Sie da für ein seltenes Stück?« rief meine Frau, nach der Lampe greifend. »Das habe ich ja noch nie bei Ihnen gesehen.«
»Es ist heute erst für das Museum zum Kauf angeboten; ich hatte selbst noch nicht Zeit zur näheren Untersuchung.«
»Und woher stammt die Lampe?«
»Man hat sie im Tigris gefunden, daran ist kein Zweifel, die Belege sind hier.«
Wir betrachteten die Lampe, die meine Frau in der Hand hielt.
»Im Tigris gefunden?« sagte sie. »Daran lag ja doch wohl Bagdad, und in Bagdad –«
»Stand Aladins Palast.«
»Aber die Lampe ist offenbar viel älter und nicht arabischen Ursprungs.«
»Das beweist nichts«, sagte ich. »Äladin entnahm die Lampe bekanntlich im Auftrage des afrikanischen Zauberers einem unterirdischen Gemache, wo sie vielleicht schon viele Jahrhunderte gebrannt hatte.«
»Na, da wollen wir doch gleich einmal daran reiben!« rief Alanders lebhaftes Frauchen und griff nach der Lampe.
»Was fällt dir ein, Helene!» unterbrach sie der Professor entrüstet. »Die schöne Patina! Du würdest die ganze Lampe entwerten!«
Frau Alander warf das Köpfchen in die Höhe und griff wieder nach der Arbeit. »Was nützt mir Aladins Wunderlampe, wenn man sie nicht reiben darf!«
Ich hob das Zwirnknäuel zum zweitenmal auf und wollte eben noch ein Wort zugunsten des Reibungsversuches einlegen, als meine Frau ausrief:
»Aber da unten steht eine Inschrift, sehen Sie!«
Wir fuhren wieder auf die Lampe zu.
»Es ist arabisch«, sagte der Professor. Er holte eine Lupe und zündete ein Licht an.
»Wenn es doch Aladins Lampe wäre!« rief Frau Alander. »Dann wird sie gerieben trotz Patina!«
Sie klopfte energisch mit der Häkelnadel auf den Tisch.
Das Knäuel fiel hinab.
»Ist der Geist sehr schrecklich, wenn er erscheint?«
»Das kommt darauf an, wie stark man reibt«, sagte ich, mich bückend. »Gewöhnlich erscheint er in einer Wolke an der Decke; aber ich kann ihm ja befehlen, gleich unter den Tisch zu kriechen, denn Ihr erster Auftrag würde doch wohl sein, dieses Knäuel ...«
»Würden Sie sich fürchten?« fragte sie meine Frau.
»Aber du tust wahrhaftig«, sagte Alander, über die Inschrift gebeugt, »als wenn es je einen Aladin und einen Sklaven der Lampe gegeben hätte. Man muß doch den Unsinn nicht übertreiben.«
»O bitte«, rief ich, »da sind Sie noch sehr in der Kultur zurück, werter Freund! Es ist wahr, bis vor kurzem hielt man die überlieferten Märchen und Geistergeschichten für Produkte der Volksphantasie und für Erdichtungen, so gut wie die Wundertaten der Heiligen als mythische Ausschmückungen frommer Verehrung galten, oder die Heilungen im Asklepios-Tempel für Schwindel habgieriger Priester. Aber seitdem wir eine transzendentale Psychologie haben, eine Gesellschaft für übersinnliche Experimente und eine Wissenschaft der Mystik, seitdem Hellseher, Geister-Zitationen und Doppelgängerei als unwiderlegbare Tatsachen festgestellt sind, seitdem weiß man auch, daß Menschen wirklich mit ihrem transzendentalen Astralleibe durch die Luft fahren können und daß Asklepios einer Frau den Kopf wieder angeheilt hat, den man ihr abgeschnitten hatte, um einen Wurm bequemer aus dem Leibe ziehen zu können. Alles, was Altertum und Mittelalter von Wunderdingen und Hexereien erzählen, ist fälschlich für Poesie oder Aberglauben gehalten worden; man weiß jetzt, daß es sich um wissenschaftlich erklärbare Tatsachen handelte. Odysseus ist wirklich im Hades gewesen und Dante von Virgil durch die Hölle geführt worden. Der heilige Antonius hat gleichzeitig in Montpellier gepredigt und in seinem Kloster das Halleluja gesungen. So gut wie ein arabischer Scheich den Kalifen durch Verkürzung der Zeitanschauung, indem er ihn den Kopf in einen Eimer Wasser stecken ließ, tatsächlich viele Jahre des Elends zu durchleben zwang, so gut wird auch die Erzählung von Aladins Wunderlampe sich als wahr bestätigen. Man muß sich nur die Mühe geben, die Wirkung und Macht des an die Lampe gebannten Geistes durch die Methode der Transzendental-Psychologie zu erklären.«
Alander richtete sich von seiner Beschäftigung auf; er hatte offenbar den letzten Teil meiner Rede gar nicht mehr gehört. »Seltsam«, sagte er. »Wissen Sie, was hier steht? Ganz deutlich ist zu lesen: ›Aladin aus Bagdad‹; dahinter, ungefähr dem Sinne nach: ›Versuche kein Gläubiger, was Allah hier verbor- gen!‹«
Wir schwiegen, unwillkürlich betroffen.
»Die Schrift ist alt«, fuhr Alander fort, »im zwölften oder dreizehnten Jahrhundert eingeritzt. Höchst interessant, wahrscheinlich nur ein Zufall – Aladins hat es in Bagdad Tausende gegeben –, denkbar aber wäre ja eine Beziehung auf das Märchen, und dann läge darin ein Beweis, daß der Ursprung desselben sehr viel älter ist, als die uns vorliegende ägyptische Fassung. Ein Scherz also, den man schon damals sich gemacht – vielleicht der Versuch eines Betrügers, die Lampe als Wunderstückchen an den Mann zu bringen – jedenfalls höchst interessant.«
»So sollten wir doch einmal versuchen –«
»Aber Helene, ich bitte dich!«
»Hier unser Freund behauptet, die Sache ließe sich erklären –« Alander lachte. »Nun, die Erklärung können wir uns ja einmal anhören. Schießen Sie los, Märchenphilosoph.«
»Zunächst behaupte ich, daß die Geschichte von Aladin und der Wunderlampe kein frei erfundenes Märchen ist, sondern, auf einer Tatsache des mystischen Lebens beruht. Natürlich nicht in allen Einzelheiten. An Ausschmückungen mag es nicht fehlen. Aber der Kern der Sache scheint mir dieser. Ein afrikanischer Zauberer, sagt die Erzählung, erfährt von dem Vorhandensein einer Wunderlampe, welche die Eigenschaft hat, daß an ihren Besitz der Gehorsam eines mächtigen Geistes geknüpft ist. Um sie zu erreichen, bedarf er der Hand eines Knaben; durch einen Zufall bleibt der Knabe im Besitze der Lampe und gewinnt dadurch Macht und Reichtum. Im Lichte der Wissenschaft stellt sich die Sache folgendermaßen: Der Zauberer aus Afrika ist ein Mann, welcher Kenntnis der Hieroglyphen besitzt und aus einem aufgefundenen Papyrus das Geheimnis der Lampe erfahren hat. Die Fundamentalfrage ist nun diese: Erstens. Ist es möglich, daß es Geister gibt, welche Dinge auszurichten vermögen, die den uns bekannten Naturgesetzen scheinbar widersprechen? Zweitens. Ist es möglich, daß der Wille dieser Geister an den Besitz eines einfachen Gerätes, wie dieser Lampe, gebunden ist? Ich wende mich zu der ersten Tatsache. Erfahrungsmäßig beglaubigt ist sie durch die Ansicht des Altertums und des Mittelalters im Orient wie Okzident. Zahllose Zeugnisse der Schriftsteller sprechen dafür. Nur die Zweifelsucht des Aufklärungszeitalters hat den materialistisch angehauchten Teil der modernen Welt dazu gebracht, sich auf die bloße sinnliche Erfahrung zu beschränken, jeden übersinnlichen Einfluß zu leugnen. Aber Demokrit, Platon, Aristoteles, Epikur, Seneka, Plinius, Plotin, die Kirchenväter, Avicenna, Albert der Große, Thomas von Aquino, Paracelsus, Luther, Cardano, Kepler, Helmont, Swedenborg, Schopenhauer und Carlos v. Prellheim, die größten Geister aller Zeiten, sind von der Wirkungsmacht der übersinnlichen Welt überzeugt gewesen. Die Tatsache ist also erwiesen. Auf Grund der übersinnlichen Weltanschauung ist sie unschwer zu erklären. Es wäre lächerlich, zu behaupten, daß es nicht außerhalb der Menschheit noch andere bewußte Geister geben sollte, die aber, mit anderen Sinnen ausgerüstet, nur bedingungsweise mit uns in Verkehr treten können. Solche Geister sind unabhängig, zwar nicht von den Gesetzen der Natur, aber von der Art, wie diese Gesetze unseren Sinnen in der Erfahrung erscheinen. Sie können also Wirkungsmittel zu ihrer Verfügung haben, die uns noch vollständig unbekannt sind, denen wir gegenüberstehen wie die Wilden dem Fernrohr, der Dampfmaschine, dem Telefon. So gut wie wir Schallschwingungen durch Umwandlung in elektrische Energie an einen entfernten Ort versetzen, könnten sie beliebige Materien von einem Ort an den ändern übertragen. Denn was wir Stoff nennen, ist nichts anderes als eine besondere Form der Äther-Energie. Hier dieser Körper, dieses Metall, dieser Muskel, dieser Nerv werden in einer fortgeschrittenen Zukunft in elektrische Schwingungen umgewandelt und fortgeleitet werden, so daß sie an einem beliebigen Ort wieder zum Vorschein kommen. Diese Geister können bereits jetzt, was wir in Jahrtausenden selbst können werden. Was tut denn der Geist der Lampe? Er bringt Speisen, Schätze, Sklaven, er versetzt den Bräutigam der Kalifentochter in der Brautnacht an einen nicht näher zu bezeichnenden Ort, wo er ihn auf den Kopf stellt; er erbaut in einer Nacht einen Palast und translociert ihn nach Afrika und zurück. Das alles läßt sich wissenschaftlich erklären durch das einfache Prinzip der Telephorie der Materie. Dieses Prinzip erscheint uns nur wunderbar, weil es noch ungewohnt ist; aber neu ist ja nur die Geschwindigkeit der Übertragung. Auch wir bauen Paläste und verrücken Stadtviertel; daß der Geist in kurzer Zeit durch große Distanzen wirkt, ist nur ein quantitativer Unterschied. Dafür steht er auf einem höheren Kulturstandpunkte. Dies erklärt auch, daß er Menschen zu versetzen vermag. Er ist mit der Abtrennung des transzendentalen Bewußtseins vertraut und organisiert schnell einen zweiten Körper, das Phantom, welches er an einem andern Orte erscheinen läßt. Dieses Verfahren ist unter dem Namen Majava-Rupa in Indien seit den ältesten Zeiten bekannt. Die Möglichkeit der scheinbaren Zaubereien des Geistes ist also erwiesen.«
»Aber –«
»Bitte. Schwieriger ist die zweite Frage. Woher stammt der Geist, und wie kann sein Wille an den Besitz der Lampe gebunden sein? Ich muß gestehen, ich bin zu sehr Neuling in der Transzendental-Psychologie, um mit Sicherheit das Richtige zu treffen; andere werden bessere Erklärungen geben können. Ich denke mir die Sache folgendermaßen: Die Individuen des Geisterreiches bilden eine ethische Gemeinschaft; es wird daher auch die Notwendigkeit einer Bestrafung eintreten können. So wie sich das transzendentale Ich einen menschlichen Körper organisiert, um seine Erfahrung durch die irdische Inkarnation zu erweitern, und währenddessen an die Gesetze des sinnlichen Organismus gebunden ist, so wird ein ethisch unreifer Geist auch zur Strafe an ein Kunstprodukt, einen Ring, eine Lampe gefesselt werden können. Denn Gerätschaften sind Organ-Projektionen; das heißt nichts anderes als Organisationen zweiter Ordnung; daher ist die Strafe für den Geist eine härtere. Außer seinem Astralleib hat er jetzt nicht, wie wir, einen Eiweißleib, sondern einen Metalleib. Das Reiben der Lampe entspricht genau dem sogenannten magnetischen Streichen beim Hypnotisieren. Das transzendentale Bewußtsein wird dadurch frei, sein Wille aber ist von dem des Magnetiseurs abhängig. Ich erinnere an die bekannten Erscheinungen der Suggestion, wobei man dem Hypnotisierten jede beliebige Vorstellung beibringen und ihn zu jeder Handlung bestimmen kann. Es wäre ein Mangel an logischer Konsequenz, wollte man nicht auch dem an die Lampe gebundenen Transzendental- Bewußtsein die Fähigkeit zusprechen, durch Streichen von seinem Leibe befreit zu werden; es ist dann ganz selbstverständlich, daß der Hypnotiseur der Lampe den Geist nach seinem eigenen Willen lenken kann. Ich erkläre also mit voller Bestimmtheit und aus meiner wissenschaftlichen Oberzeugung: Aladins Sklave der Lampe hat existiert und seine erstaunlichen Taten verrichtet. Wenn seine Strafzeit nicht schon beendet, so ist er noch jetzt an die Lampe gebunden. Und wenn diese Lampe vor uns, wie mir zweifellos scheint, die echte Lampe Aladins ist, so bin ich bereit, empirisch zu erweisen, daß der Geist auch mir gehorchen muß.«
»Sehr schön demonstriert!« rief Alander belustigt. »Das könnte wörtlich in der ›Sphinx‹ stehen. Wenn ich nur sicher wäre, daß mir der Geist auch die abgeriebene Patina wieder ›reorganisieren‹ kann.«
»Schade«, sagte meine Frau, »es war mir so nett zu denken, daß dies die Lampe Aladins sei. Aber nachdem du die Sache philosophisch bewiesen hast, bin ich überzeugt, daß kein Wort davon wahr ist.«
»Das tut mir leid. Dir fehlt das Organ des wissenschaftlichen Glaubens. Aber Sie, Frau Alander, Sie sind ein Sonntagskind, Sie werden an dem Geiste der Lampe nicht zweifeln.«
»Wissen Sie«, sagte Frau Alander, »wenn ich ganz offen sein soll, Ihre gelehrte Rede habe ich noch nicht ganz verstanden; die müßte ich erst einmal gedruckt lesen. Ich sage ganz einfach, wenn die Geschichte wahr wäre, so hätte der Zauberer die Lampe sich selber geholt und wäre nicht erst auf Aladin verfallen.«
»O weh! Ich glaube, ich hätte so schön populär gesprochen! Ihr Einwand ist übrigens gar nicht stichhaltig, denn bei allen mystischen Operationen bedarf es erfahrungsgemäß eines Mediums, und jedenfalls hatte sich der Zauberer überzeugt, daß Aladin dazu geeignet sei. Auch das Anzünden von Räucherwerk auf der Steinplatte vor dem Eingange spricht dafür, daß Aladin in somnambulem Zustande handelte. Wie hätte er auch sonst drei Tage zu hungern vermocht?«
»Was ist aber aus der Lampe nach Aladins Tode geworden?«
»Er wird sie vorher selbst, um Mißbrauch zu verhüten, in den Tigris geworfen haben.«
»Und wie erklären Sie denn überhaupt die Existenz des unterirdischen Gewölbes und die Aufstellung der Lampe daselbst?« fragte Alander.
Diese Frage setzte mich etwas in Verlegenheit. Ich hob daher erst zum sechsten Male das Zwirnknäuel meiner fleißigen Nachbarin auf und sagte dann:
»Ich könnte mich darauf berufen, daß wir hier eine historische Tatsache einfach hinzunehmen haben. Aber auch vom theoretischen Standpunkte ist doch klar: So gut wie eine Pflanze zu ihrer Entwicklung einen geeigneten Nährboden haben muß, so gut wie ein transzendentaler Geist nicht aus der freien Luft sich seinen Körper organisieren kann, sondern des Mutterschoßes bedarf, ebensogut kann auch der Metalleib des Lampengeistes nur in der geeigneten Umgebung erzeugt werden. Vermutlich befand sich dort eine transzendentale Goldschmiede, wofür auch das Vorhandensein der Edelsteinfrüchte spricht. Der ägyptische Papyrus, aus welchem der sogenannte Zauberer seine Kenntnis entnahm, war vielleicht eine durch Hellsehen hergestellte, geologische Karte des Altertums.«
»Sie sind nicht zu widerlegen.« Alander lachte, noch immer ungläubig. »Ich will also hier diese schon etwas beschädigte Stelle Ihrem Experimente preisgeben. Nun bin ich doch neugierig, wie Sie den Geist hervorzaubern werden.«
»Das ist brav! Das ist herrlich!« riefen die Frauen wie aus einem Munde.
Ich stellte die Lampe vor mich auf den Tisch. Feierlich näherte ich ihr meine Hand. Alle verhielten sich still. Es wurde mir doch etwas ängstlich zumute. Ist's nicht ein Frevel, das Jenseits zu versuchen, den Isis-Schleier des Geisterreichs zu lüften? Und setzte ich nicht die Anwesenden einer unbekannten Gefahr aus? Aber es galt, eine wissenschaftliche Theorie zu bestätigen, es mußte sein! Und wenn der Versuch mißlang? Wenn der Geist seine Strafzeit abgebüßt und seine leere Hülle zurückgelassen hatte? So war doch wenigstens dies konstatiert. Ich sah die Augen der Frauen erwartungsvoll auf die Lampe gerichtet. Auch ihnen war es unheimlich. Nur Alander rauchte unerschütterlich.
»Nicht zu stark«, flüsterte seine Frau.
Ich strich mit dem Finger leise über die Lampe, zwei-, dreimal; ich verstärkte den Druck. Ich nahm die ganze Hand zu Hilfe. Der Geist erschien nicht.
»Meine Patina!« rief Alander.
»Sie haben die Sitzung unterbrochen! Gedulden Sie sich noch!«
»Vielleicht muß sie angezündet sein«, bemerkte meine Frau.
»Davon steht nichts in der Geschichte. Aber vielleicht muß man sie in der Hand halten.«
»Geben Sie her«, rief Frau Alander, die wieder Mut bekommen hatte. »Ich will einmal tüchtig scheuern, wie Aladins Mutter!«
»Nicht Sie!«
Schnell ergriff ich die Lampe, zumal sich auch Alander ihrer bemächtigen wollte. Ich hielt sie in der Linken und fuhr rasch ein paarmal mit der Rechten darüber.
»Hören Sie nichts?
»Nein.«
»Ja.«
»Doch.«
Kein Zweifel, aus der Lampe drang ein knarrendes Geräusch.
»Der Geist scheint eingerostet«, spottete Alander.
»Pst! Ruhig! Eine Stimme tönt aus der Lampe!«
Es wurde mäuschenstill im Zimmer. Wir wagten nicht zu atmen. Das Blut stockte in unsern Adern. Alander beugte sich weit vor.
»Der Kerl spricht arabisch«, sagte er.
»Geist der Lampe, sprich deutsch!« rief ich feierlich.
Leise, aber deutlich vernehmbar klang es aus der Lampe:
»Ich bin der Sklave der Lampe und bereit zu gehorchen allen, welche Herren der Lampe sind.«
»Wo bist du, Geist?«
»In der Lampe.«
»Warum zeigst du dich nicht?«
»Ich darf nicht. Sobald ich mich für alle menschlichen Sinne im Räume objektiviere, bin ich den Gesetzen der Natur und der Gesellschaft unterworfen, welche zur Zeit gelten. Da es im modernen Staate keine Sklaverei gibt, so würde ich nach meiner Inkarnation frei sein. Es ist mir daher geboten, mich nur akustisch zu materialisieren.«
»Wie? So schreitet auch das Geisterreich fort?«
»Auch wir sind dem Gesetze der Entwicklung durch Anpassung unterworfen.«
»Und kannst du noch meine Befehle erfüllen?«
»Alles, was du befiehlst, kann ich tun, soweit es nicht den Naturgesetzen widerspricht.«
»So wünschen Sie«, sagte ich leise.
Die Frauen schwiegen und sahen sich an. Alander kam ihnen zuvor.
»Hören Sie, Ihr Geist scheint mir bedenklich zivilisiert. Wir wollen gleich sehen, ob er wirklich echt ist. Lassen Sie ihn doch einmal dreihunderttausend Mark in Gold auf den Tisch legen.«
»Sklave der Lampe«, rief ich, »bringe dreihunderttausend Mark in Gold!« »Das kann ich nicht, Herr«, erwiderte der Geist, »das widerspricht den Gesetzen.«
»Wieso?«
»Alles gemünzte Gold gehört irgendwem als Eigentum. Ich darf es niemand wegnehmen.«
»So schaffe ungemünztes!«
»Das kann ich nicht, das wäre gegen das Gesetz von der unveränderlichen Erhaltung des Stoffes.«
»Hole es aus der Erde!«
»Das kann ich nicht. Dazu bedarf es mehr mechanischer Arbeit, als in meinem gegenwärtigen Körper angehäuft ist. Das wäre gegen den Satz von der Erhaltung der Energie.«
»Elender Sklave«, rief ich, »warum konntest du es Aladin bringen?«
»Damals wußte man noch nichts von der Erhaltung des Stoffes und der Energie.«
»Wie, du willst doch nicht behaupten, daß diese Naturgesetze damals nicht in Geltung waren?«
»Die Naturgesetze«, antwortete der Geist, »sind nichts anderes als der Ausdruck des wissenschaftlichen Bewußtseins einer bestimmten Zeit. In meinem transzendentalen Bewußtsein bin ich davon unabhängig; aber in meiner Tätigkeit in der Zeit, in eurer Zeit, darf ich die Bedingungen nicht durchbrechen, welche die Grundpfeiler der modernen Kultur sind. Wir können zu der unkritischen Weltanschauung einer entschwundenen Epoche nicht zurückkehren.«
»Ihr Geist ist doch ein braver Kerl«, sagte Alander. »Er ist zehnmal gescheiter als ihr Transzendental-Psychologen. Fragen Sie ihn einmal nach etwas, was die Zukunft erst entdecken wird.«
»Sklave der Lampe, worauf beruht die Schwerkraft der Körper?«
»Das kann ich dir nicht sagen. Es wäre gegen das Gesetz der kontinuierlichen Entwicklung der mathematischen Naturwissenschaften, wenn es heute ein Mensch schon wüßte.«
»Ein verteufelter Schlaukopf! Lassen Sie ihn laufen!«
»Nicht doch«, riefen die Frauen, »wir wollen auch etwas wünschen!«
»Ich bitte darum«, sagte ich ziemlich deprimiert, »wenn es nur etwas nützt!«
»Sag ihm, er solle uns jetzt alle vier an den Golf von Neapel versetzen.«
»Du hörst, Sklave, was, meine Frau befiehlt – gehorche!«
»O Herr, das ist gegen die Gesetze der Mechanik!«
»So bringe uns in somnambulen Zustand und führe unsere Astralleiber dahin!«
»Früher konnte ich alles tun, weil man alles für möglich hielt. Jetzt kann ich den Astralleib nur bei solchen Menschen abtrennen, welche dazu nervös disponiert sind. Von den geehrten Anwesenden ist aber niemand mediumistisch veranlagt.«
Meine Frau zuckte mit den Schultern und sagte: »Ich dachte mir schon, daß es wieder nichts sein würde. Ich soll nicht nach Italien kommen!«
Ich war innerlich wütend über den degenerierten Geist und wünschte die Lampe niemals angerührt zu haben. Ich seufzte.
Alander rieb sich schmunzelnd die Hände und sagte: »Der Geist scheint Ihnen schlecht zu bekommen. Sie sehen schon ganz schwach aus; hätten Sie nur lieber den Apfel des Lebens gewählt! Nun, Helene, jetzt bist du an der Reihe, vielleicht gelingt dir's besser.«
Frau Alander stützte den Arm auf den Tisch und zupfte nachdenklich an ihren Stirnlöckchen.
»Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll«, sagte sie. »Nach Italien kann uns der Geist nicht bringen, aber er wird uns noch halbtot ärgern. Kann er uns vielleicht ein Universalmittel verschaffen?«
»Sklave, bring ein Lebenselixier!«
»Herr, das gibt es nicht. Heutzutage hat man nur Spezialisten.«
»Wünschen Sie etwas anderes, Frau Professor? Ich bedaure sehr –«
»Je nun«, sagte sie und griff wieder nach ihrer Handarbeit, »ich bin eigentlich ganz zufrieden und brauche im Augenblick weiter nichts.«
Das Zwirnknäuel fiel unter den Tisch.
»Ei«, rief meine Nachbarin weiter, »so wünschte ich doch, daß das Knäuel nicht mehr hinunterfallen kann!«
»Sklave«, sagte ich, »du hast gehört, gehorche!«
»Herr«, antwortete der Geist kläglich, »ich kann es nicht bewirken, es wäre gegen die Fallgesetze Galileis und gegen die Naturgeschichte der weiblichen Handarbeiten!«
»Zum Teufel«, rief ich ärgerlich, »was kannst du eigentlich, fauler Bursche?«
»Alles, was nicht gegen ein Gesetz verstößt, das durch das Bewußtsein der Zeit verbürgt ist. Aber mir ist bestimmt, ich solle erlöst sein, sobald mein Herr keinen Wunsch mehr zu nennen weiß, bei dessen Gewährung ich nicht durch mein Eingreifen den Kausälzusammenhang der Welt zerstören würde.«
»Nun denn«, sagte ich resigniert, »so hebe wenigstens das Knäuel auf, das wird ja doch wohl gegen kein Gesetz verstoßen.«
»Verzeiht mir, Herr, auch das ist mir nicht möglich.«
»Und warum nicht?«
»Nach den Gesetzen des Universums, deren Notwendigkeit die moderne Wissenschaft voraussetzt, ist deinen Muskeln bestimmt, heute abend durch Beugen deines Rumpfes neunhundertsechzehn-Komma-elf Meter-Kilogramm Arbeit zu leisten. Wenn ich dir hiervon auch nur fünf Prozent abnähme, so würde ein Überschuß an Energie in dir aufgespeichert werden, welcher sich in Gehirntätigkeit umsetzen und einen transzendental- psychologischen Artikel erzeugen würde; denn hierzu genügt schon ein Minimum von Energie. Dadurch würden zwar sechsundzwanzig Leser veranlaßt werden, das betreffende Blatt abzubestellen; einer aber würde es so eifrig lesen, daß er, dabei einschlafend, dem Licht zu nahe käme. Es entstünde ein Hausbrand, welcher sich einem ganzen Stadtviertel mitteilte; ein Arsenal flöge in die Luft; die Explosion würde den Anziehungsmittelpunkt der Erde um den tausendsten Teil eines Millimeters verschieben; dadurch aber würde die Erde um zwei Millionen Jahre zu früh in die Sonne stürzen. Du siehst also, daß es mir unmöglich ist, das Knäuel aufzuheben.«
»Oh, weiser Geist!« rief ich. »Wir sind deiner nicht wert- du bist entlassen!«
Ich setzte die Lampe auf den Tisch. Ein Lichtschein schoß daraus hervor und verlor sich als leichte Wolke an der Decke. Wenigstens schien es mir so.
Aus der Ferne tönte es leise: »Dank, Dank für die Erlösung nach dreitausendjähriger Haft! Zur transzendentalen Freiheit flieh ich aus dem Zeitalter der Notwendigkeit! Es fällt kein Knäuel vom Tische, dessen Sturz nicht durch das Weltall zittert!«
Ich hob das Knäuel auf und legte es neben die Lampe. Es rollte wieder hinab.
»Sie können sich als Bauchredner hören lassen«, sagte der Professor.
Solche Leute sind nicht zu überzeugen.
Wir verdanken die Entdeckung der Sprache und Schrift der Ameisen den Bemühungen des berühmten Entomologen Antenna. Bekanntlich leben in den Gemeinden dieser hochorganisierten Tiere nicht bloß Männchen, Weibchen, geschlechtslose Arbeiter und sogenannte Krieger oder Führer mit größeren Köpfen, sondern auch Haustiere, insbesondere ein kleiner Käfer (Claviger), von welchem man nicht wußte, welche Bedeutung er für die Ameisen besitzt. Antenna ist es gelungen, nachzuweisen, daß dieser Käfer die lebendige Bibliothek der Ameisen vorstellt. Die Sinneswahrnehmungen der Ameisen beruhen auf Ätherwellen von 800 bis 2000 Billionen Schwingungen in der Sekunde, deren Geschwindigkeit somit jenseits derjenigen liegt, welche für unser Auge als Licht wahrnehmbar sind. Antenna ermöglichte es, durch ein Fluoreszenz-Mikroskop jene Ätherschwingungen so zu verlangsamen, daß sie für unsere Sinneswerkzeuge bemerkbar werden. Dadurch zeigte er, daß die Ameisen gegenseitig in einer Fühlersprache verkehren, die er Chemisieren oder Übertasten nennt, und daß sie dieselbe, ähnlich wie wir Schallwellen auf den Phonographen, auf die Keulenkäferchen übertragen, welche sie ihrerseits jederzeit reproduzieren können. Die Ameisen haben also den Menschen in der Kultur insoweit überflügelt, daß ihre Haustiere nicht nur zur mechanischen, sondern auch zur intellektuellen Arbeit abgerichtet werden. Wir sind in der Lage, im nachfolgenden die Übersetzung eines Ameisentagebuches zu veröffentlichen, welches auf 82 Keulenkäferchen chemisiert war. Wir haben dabei häufig die umständlichen Umschreibungen der Ameisensprache durch die uns geläufigen Ausdrücke ersetzen müssen; selbstverständlich geschah dies überall dort, wo es sich um die Wiedergabe ursprünglich menschlicher Äußerungen handelt.
Über das Nähere des sehr schwierigen technischen Verfahrens, die Tastungen der Keulenkäferchen zu fixieren, müssen wir auf das Originalwerk Antennas verweisen, welches in lateinischer Sprache unter dem Titel »De formicarum lingua et litteris« bei Gebrüder Emswind in Flausenheim erschienen ist.
Große Frühjahrsräumerei. Die Arbeiter sind mit den Kleinsten draußen im ersten Sonnenschein, der Stock ist fast leer. Wir Führer sitzen noch in den Winterzellen und denken nach.
Es ist jetzt die schönste Zeit im Stock, ich will sie benutzen, um mich einmal gründlich in der neueren Literatur umzusehen. Ich habe angefangen, das vielgerühmte Buch von Ssrr zu studieren: »Leben und Treiben des Menschen«. Es ist zwar rotameisenisch geschrieben, aber ich verstehe es ganz gut. Etwas idealistisch, viel Hypothese – indes, die Roten sind einmal so. Weil sie keine Sklaven halten, bilden sie sich ein, an der Spitze der Zivilisation zu marschieren.
Nun, wir sind schließlich doch alle Ameisen, und ein Boden ist unter uns allen!
Ssrr behauptet wahrhaftig, der Mensch besitze Intelligenz! Er soll allerdings Gehirn haben, aber dann müßten doch seine Fühler am Kopfe und nicht an den Brustringen sitzen.
Ich überzeuge mich mehr und mehr, daß Ssrr recht hat; der Mensch scheint in der Tat unter den ungeschlachten Bestien, die man Knochentiere nennt, den ersten Rang einzunehmen. Bisher hatte ich immer die Vögel für die bevorzugtere Klasse gehalten, nicht nur, weil sie uns am gefährlichsten sind, sondern weil sie sich in vielen Dingen den Ameisen wirklich auffallend nähern. Sie bauen Nester, haben eine äußere schützende Federhülle, besitzen Flügel und legen sogar Eier. In dieser Hinsicht steht der Mensch weit hinter ihnen zurück, mit Ausnahme des Nestbaues. Es scheint kein Zweifel, daß die Menschen sogar gleich uns gemeinsame Stöcke anlegen, welche zwar nicht geräumig genug sind, um einen ganzen Staat zu umfassen, aber doch immerhin für ein so großes Tier eine nennenswerte Leistung darstellen. Danach müßte man annehmen, daß sich die Menschen einigermaßen untereinander verständigen können; unzureichend genug mag das sein, da ihre Fühler so grob organisiert sind!
Eine Beobachtung, die ich früher einmal selbst gemacht habe, scheint dafür zu sprechen. Ich sah einen noch nicht ganz erwachsenen Menschen im benachbarten Felde auf einem Apfelbaum sitzen und fressen. Ein größerer schlich sich heran, hob den einen Fühler in die Höhe und ergriff jenen am Beine, so daß er herabfiel. Es schien mir dabei, als wenn der andere Fühler noch einen dünneren Fortsatz hätte, der sich in schwingender Bewegung befand. Beide Menschen betasteten sich hierauf lebhaft mit ihren Fühlern, worauf der kleinere plötzlich in großer Eile davonlief. Was mögen sie sich wohl zu sagen gehabt haben? Ob sie eine Sprache besitzen, oder ob alles nur auf Nachahmung beruht? Vielleicht hatte der kleinere Mensch schon in früheren Fällen die Erfahrung gemacht, daß das Davonlaufen mit irgendeinem Vorteil verbunden sei. Oder sollte es sich um einen ererbten Instinkt handeln? Ich bin neugierig, was Ssrr über diese Frage sagen wird. Vorläufig bin ich erst bei der Beschreibung des menschlichen Organismus.
Wie weise hat doch die Erde selbst für ihre plumpsten Geschöpfe gesorgt! Auch beim Menschen ist der edelste und ameisenähnlichste Teil, das Gehirn von einem schützenden Knochengerüst umgeben, während im übrigen Körper die festen Stützen im Innern liegen. Um wieviel höher steht somit die Organisation der Insekten, bei welchen der ganze Körper von der festen Chitinhülle umschirmt ist! Die Zoologen, welche nur den Körperbau in Betracht ziehen, wollen wirklich die Ameise zu den Tieren rechnen und ihr nur die höchste Entwicklungsstufe zusprechen. Aber ich lasse mir die Überzeugung von der ewigen Bestimmung des Ameisengeschlechts nicht rauben!
Ameise und Mensch sollen beide vom Regenwurm abstammen! Blödsinn!
Ob wohl die Menschen auch zu irgend etwas nutze sind? Sollte die unendliche Uremse bei der Schöpfung nicht auch ihnen eine Stelle im Weltall eingeräumt haben? Es scheint, daß sie wesentlich zur Vertilgung der so schädlichen Vögel beitragen. Und wenn sie auch keinen weiteren Zweck hätten, als uns zum Gegenstand wissenschaftlicher Studien zu dienen, so würden sie schon darum nicht überflüssig in der Welt sein. Sicherlich besitzen sie Gefühl und freuen sich ihres Daseins so gut wie wir, obwohl ihnen die höheren Ideale des Gemeinsinns sowie der Puppen- und Larvenpflege abgehen und ihnen selbstverständlich das »Unbewußtsein der unvermeidlichen Handlungsweise« fehlt. Ich kann mich daher mit der Ansicht nicht befreunden, daß man eine Expedition zur Erforschung des Menschengehirns absende. Ssrr verlangt, man solle eine Kolonie im Schädel eines lebenden Menschen anlegen, um die geistigen Fähigkeiten desselben zu ergründen. Aber mir scheint darin eine gewisse Grausamkeit zu liegen. Wie leicht könnte der betreffende Mensch darunter leiden. Es ist freilich nur ein Mensch, und sein Wohlergehen darf gegenüber dem Fortschritt der ameisenlichen Erkenntnis nicht in Frage kommen. – Während ich diese Aufzeichnungen meinem Keulenkäferchen übertaste, wendet es das Köpfchen und streichelt mich mit seinen Fühlern. Gewiß will es zeigen, daß es auch Lust und Schmerz empfindet wie unsereins. Es ist allerdings ein Insekt und steht uns näher als der Mensch, aber trotzdem sage ich: Auch der Mensch ist ein Lebewesen, auch er hat ein Recht auf unsere Schonung!
Wer weiß, ob uns das Klima des Menschengehirns zusagen würde? Unsere Mitbürger sollen sich derartigen Gefahren nicht aussetzen; mögen die Rotameisen ihre Abenteuerpolitik allein treiben!
Ärgernis mit den Sklaven. Sie haben die Zuckerkühe schlecht gemolken. Nr. 18 und 24 haben fünf Lasten Saft allein aufgegessen; wurden gründlich abgezwackt! Wahrhaftig, man wünschte manchmal ein unvernünftiger Mensch zu sein und in, den Tag hinein zu leben. Was kennt so ein Mensch für Sorgen? Sie haben weder Eier noch Larven noch Puppen, und daß sie wirklich Haustiere und Sklaven halten sollten, wie Ssrr behauptet, kann ich nicht glauben. Wozu könnten sie die brauchen? Wenn sie auch ihre Jungen mit den Fühlern bearbeiten, was auf eine gewisse rudimentäre Erziehungskunst deutet, so hat doch jeder seine eigenen Kinder - Staatskinder kennen sie nicht. Welch niedriger Standpunkt!
Ich bin ganz erstaunt und betroffen! Was hat doch unser Geist schon entdeckt! Die Menschen können sich wirklich gegenseitig Mitteilungen machen. Eine Sprache im eigentlichen Sinne haben sie freilich wohl nicht, sie müßten denn auf so langsamen Schwingungen beruhen, daß unser feineres Organ sie nicht aufzufassen vermag. Ihre Sinne müssen überhaupt sehr grob gestaltet sein. Ssrr hat z. B. nachgewiesen, daß der Mensch in der Nacht absolut nicht sehen und seine Umgebung nicht unterscheiden kann. Es kommt vor, daß Menschen, die in der Nacht nach Hause kommen, den Eingang zu ihrem Stock nicht finden.
Es wird wirklich eine Expedition zur Erforschung der Menschen ausgerüstet, aber man ist davon abgekommen, sie ins Gehirn zu schicken, sie soll sich vielmehr mit der Entdeckung der menschlichen Sprache beschäftigen. Man hat nämlich folgende höchst interessante Beobachtung gemacht. Wenn ein Mensch für einen andern eine Mitteilung hinterlassen will, so überträgt er nicht, wie wir, seinen Gedankenprozeß durch Fühlerschwingungen chemigraphisch auf den lebendigen Organismus eines Keulenkäferchens, welches denselben jederzeit reproduzieren kann, sondern er verändert mit Hilfe eines Saftes die Oberfläche einer hellen, blattartigen Substanz an ganz bestimmten Stellen, so daß darauf mehr oder weniger regelmäßige Zeichen entstehen. Der andere Mensch hält dieselben vor seinen Augen und ist auf eine uns unbekannte Weise imstande, daraus die Meinung des ersten zu erkennen. Es muß wohl aber dieses Mitteilungsmittel ein ziemlich unvollkommenes sein, da man nach dieser Operation Menschen häufig den Kopf schütteln sieht, was man für ein Zeichen des Mißbehagens hält. Ssrr nennt enen Saft »Tinte«, er soll bei den Menschen sehr hochgeschätzt sein und in einer besonderen Drüse, dem Tintenfaß, abgesondert werden. Diejenigen Menschen, welche das größte Tintenfaß haben, sollen im höchsten Ansehen stehen und von den andern gefürchtet werden. Ich vermute, daß jener Saft ähnlich ätzende Eigenschaften wie unsere Säure hat und im Kampfe ausgespritzt wird. Ob er auch giftig wirkt?
Man merkt, daß es Sommer ist. Wir haben schon eine Menge Puppen im Stock, ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Einige von unsern Müttern fangen an, recht alt zu werden. Die gute Xrr ist seit zwei Jahren nicht aus dem Stock gekommen, einen Menschen hat sie noch nie gesehen. Daß es solche Wesen gebe, hält sie für einen Aberglauben Als ich ihr sagte, daß ein Mensch mit einem Schritt über einen ganzen Baum hinübersteigen könne, schlug sie die Fühler über dem Kopfe zusammen, und nur, daß er auf bloß zwei Beinen geht, beruhigte sie einigermaßen. Sie fand dies sehr unschicklich und wollte nichts weiter hören. Dann aber fragte sie doch, ob bei den Menschen die Weibchen in der Jugend auch Flügel hätten und sie dieselben wie bei uns nach der Hochzeit ablegten. Ich erinnerte mich, bei Ssrr gelesen zu haben, daß es geflügelte Menschen gäbe, welche sie Engel nennen, und daß die jungen Weibchen von den Männchen öfter »mein Engel« genannt würden, wenn sie älter sind, aber nicht mehr. Daraus ist wohl zu schließen, daß auch die Menschen nach der Hochzeit die Flügel verlieren.
Daß die Menschen auch religiöse Vorstellungen besitzen, hätte ich nicht geglaubt. Dennoch ist nach den Forschungen von Ssrr kein Zweifel daran, wiewohl es sich nur um einen ziemlich rohen Fetischdienst handeln dürfte. Sie haben nämlich eine Art runder Platten von einem schweren, glänzenden Stoffe mit der Abbildung eines menschlichen Kopfes, die sie als ihre Götzen anbeten. Sie verehren dieselben über alles und tragen immer einige bei sich. Wer keine solche Götzenbilder besitzt und vorzeigen kann, wird als ein verworfener Mensch betrachtet und aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen. Er kann es zu keiner angesehenen Stellung bringen und erhält nicht einmal die nötigsten Nahrungsmittel. Wer dagegen von jenen Götzenbildern eine große Menge in seinem Bau aufgehäuft hat, wird als ein heiliger Mann verehrt, alle beugen sich vor ihm, und er kann sogar die so hochgeschätzten Tintendrüsen für einige Götzenbilder erhalten.
Ein bewegter Tag. Die Arbeiter waren damit beschäftigt, unsern diesjährigen Erstlingen beim Auskriechen behilflich zu sein. Während sie ihnen die Puppenhülsen aufbissen und abzogen, saß ich wieder über meinem Ssrr, dem großen Erforscher der Menschen, den ich mehr und mehr verehren lerne. Hat er uns doch eine neue Welt eröffnet, einen Blick in den ungeahnten Reichtum der Natur an merkwürdigen Gestalten, und in jeder zeigt sich die Weisheit der unendlichen Uremse. Der Mensch, dieses riesige, täppische Tier, wie gefährlich wäre er unseren Staaten, wenn er bei seiner zweifellosen Intelligenz zugleich die idealen Triebe der Ameise besäße! So aber begnügt er sich mit der Anbetung seiner blanken Götzen, und sein ganzes Streben ist darauf gerichtet, möglichst viele derselben anzuhäufen. Und dies nicht etwa für die Gemeinschaft, sondern ein jeder sorgt nur für sich; eben hier zeigt sich die Weisheit des Schöpfers, daß er die Kräfte dieser gefährlichen Riesen zersplittert und sie zu einem Kampfe des einzelnen gegen den einzelnen antreibt. Wie dankbar müssen wir sein, daß wir als Ameisen ausgekrochen sind!
Mit derartigen Gedanken war ich beschäftigt, als wir plötzlich eine gewaltige Erschütterung des ganzen Baus verspürten. An einer Stelle drang das Tageslicht ein. Die Arbeiter stürzten sich auf die Larven und Puppen, um sie in Sicherheit zu bringen, während wir Führer zur Abwehr des Angriffs hinauseilten. Wir bemerkten, daß ein Mensch mit einem Baume – sie nennen es einen Stock – in unseren Bau gestochen hatte. Er stand ganz ruhig und sah offenbar zu, was wir beginnen würden. Sofort ging eine Anzahl Arbeiter an die Ausbesserung, während ein Häufchen mutiger Führer sich auf die Füße des Menschen stürzte und an ihm hinaufkletterte. Wir drangen durch das dicke Gewebe seiner Oberhaut und zwickten, stachen und spritzten dermaßen, daß der Mensch bald die Flucht ergriff. Leider hatten wir dabei große Verluste, nur wenigen, darunter mir, gelang die rechtzeitige Rettung. Denn, höchst seltsam, sobald sich der Mensch einige Schritte in ein Gebüsch zurückgezogen hatte, begann er sich zu häuten, unsere Truppen abzuschütteln und zu zertreten. Alsdann aber schlüpfte er wieder in seine Haut hinein und ging von dannen. Bei der Untersuchung des Kampfplatzes erkannten wir, daß auch der Mensch Verluste erlitten hatte. Unter den welken Blättern des Bodens fanden wir neben den Leichen unserer Tapferen zwei der blanken Götzenbilder und eine aufgesprungene Kapsel, in welcher sich ein weicher, gelblicher Gegenstand befand, wie es schien, eine Locke menschlichen Haares. Wir beschlossen sofort, die erbeuteten Gegenstände in den Bau zu schaffen, sie waren jedoch zu schwer, und wir mußten daher erst nach Beihilfe schicken. Inzwischen schleppten wir wenigstens die Haarlocke ein Stück vorwärts. Während wir damit beschäftigt waren, kehrte der Mensch zurück, indem er offenbar am Boden etwas suchte, vermutlich seine Götzenbilder. Da wir zu schwach waren, um den Kampf wieder aufzunehmen, verbergen wir uns. Als der Mensch endlich mit seinen blöden Augen die Kapsel erkannte, stürzte er freudig darauf zu und hob sie auf; doch schien er äußerst enttäuscht, als er die Locke nicht darin fand. Die Götzenbilder beachtete er merkwürdigerweise gar nicht. Endlich entdeckte er die Locke, wo wir sie verlassen hatten. Er nahm sie auf und drückte sie wiederholt an seine Lippen, dann barg er sie samt der Kapsel sorgfältig in einer Falte seiner Haut. Diesen Vorgang kann ich mir nicht erklären. Was konnte dem Menschen an dem bißchen Haar liegen, da er selbst einen ganzen Schopf besaß? Es müssen im Menschen noch Vorgänge stattfinden, welche uns unerklärlich sind. Instinkt oder Überlegung?
Die Götzenbilder schafften wir später mit großer Mühe in unsern Bau, wo sie den Grundstock eines Menschenmuseums bilden sollen.
Nachrichten von der Expedition. Es sind ganz ungeahnte Entdeckungen gemacht worden. Die Menschen haben außer dem Verkehrsmittel der Tinte in der Tat noch eine andere Sprache mit Hilfe ihrer Kiefer. Dieselben sind bei den älteren Weibchen stärker entwickelt als bei den Männchen. Die beiden eigentümlichen Hervorragungen an den Seiten ihres Kopfes dienen dazu, die Sprache zu verstehen. Wir allerdings können diese nicht wahrnehmen, aber unsere berühmten Physiker Hlmz und Krch haben ein Instrument erfunden, welches die von den menschlichen Kiefern der Luft mitgeteilten Schwingungen in Tastenvibrationen umsetzt und uns dadurch verständlich macht.
Nun ist alle Aussicht vorhanden, daß wir mit Hilfe unserer bewaffneten Fühler bald die Menschensprache vollständig beherrschen werden. Auch ein Sehrohr ist konstruiert worden, wodurch wir selbst bei Tageslicht entfernte Gegenstände wahrnehmen können.
Jetzt geht es lustig im Stock zu! Wir haben wieder eine geflügelte Jugend. Mädchen und Knaben tummeln sich draußen, es ist nicht leicht, sie zu hüten. Frei schweben sie in der Luft, wir alten Führer laufen unten herum und sind nicht imstande, sie zu tasteln.
Nun, das Vergnügen ist ein kurzes – wenige Sonnen, und die Flügel müssen fallen!
Von der Expedition höre ich, daß die Menschen sogar Bücher über uns Ameisen geschrieben haben. Selbstverständlich lauter Unsinn! Von unsern Verkehrsmitteln haben sie keine Ahnung, unsere Organe deuten sie ganz falsch, weil sie sich nach ihren groben Sinnen richten. Sie wissen nicht, wie fein und modulationsfähig unsere Tasterschwingungen sind und daß die Keulenkäferchen die Fähigkeit haben, diese Tasterschwingungen aufzunehmen, festzuhalten und nach Belieben wiederzugeben. Daher zerbrachen sie sich den Kopf, wozu wir die Keulenkäferchen im Stock halten und füttern, denn sie können nicht begreifen, daß diese unsere lebendige Bibliothek sind. Da bilden sie sich wer weiß was auf ein neues Instrument ein, was einer von ihnen erfunden hat, um die Töne festzuhalten und wiederzugeben.
Wir haben einen solchen Apparat an unsern Keulenkäferchen schon seit Tausenden von Rundsonnen im Gebrauch. Und dabei wollen sich die Menschen zu den Kulturtieren rechnen!
Heut hatte sich eine fremde Ameise in den Stock verirrt. Sie suchte sich zu verstecken, aber ein paar Sklaven erwischten sie gleich an den Fühlern. Ehe wir sie hinauszwacken ließen, forschten wir sie über die Verhältnisse ihres Baus aus. Er liegt am Straßengraben, wo alle Tage Menschen vorüberkommen, und es scheinen dort schöne Zustände zu herrschen. Wenn dies so fortgeht, werden sie geradezu entameist. So gehen sie damit um, den Knaben gleich nach dem Auskriechen die Flügel abzubeißen, damit sie nicht mehr frei in der Luft sich umhertummeln und austoben können. Sie sollen sämtlich zu großköpfigen Gelehrten und Führern erzogen werden und werden daher mit Galläpfeln gefüttert, um womöglich eine Tintendrüse wie die Menschen zu bekommen. Von früh bis abend übertastelt man sie mit den eingetrockneten Puppenhülsen früherer Generationen, von denen man annimmt, daß besonders begabte Gelehrte aus ihnen ausgekrochen seien. Die Namen derselben werden in Verse gebracht und müssen von den armen flügelberaubten Jungen auf Käfer übertastelt werden. Der eine lautet:
Als edle Puppengreifer merk:
Psr, Klks, Mgs, Schns, Prbs, Hms und Zrk.
Kks 25 Sklaven fing,
Grx 20, 22 Lng.
So geht es weiter. Von jedem alten Führer müssen sie wissen, wieviel Sklaven und Puppen er eingebracht und wieviel Feinde er getötet hat. Ich sagte, ich fände das nicht gut, die Knaben hätten von der Natur die Flügel bekommen und verlören sie schon von selbst, wenn sie sie nicht mehr brauchten. Man solle sie nicht vor der Zeit entflügeln. Das ginge vielleicht eine Zeitlang, aber im nächsten Jahr würden sie schon sehen, was sie damit anrichten. Da erwiderte das freche Ding, bei den Menschen wäre es ebenso. Sie wurde hinausgeworfen. Hüten wir uns vor dem Vermenschen!
Die Expedition hat einige hundert Stück Käfer zurückgeschickt, denen sie ihre Erfahrungen über die Menschen übertastet hat. Da gibt es zu studieren. Einzelnes ist gar nicht zu verstehen. Bei uns weiß jeder Arbeiter im Augenblick, was für den Bau zu tun ist, und ohne Zögern legt er Kiefer ans gemeinsame Werk. Bei den Menschen – und dies bemerkte schon Ssrr – hat jeder eine andere Ansicht; viele wechseln ihre Ansicht alle Tage. Aus welchem Grunde, ist nicht ganz klar, der Wechsel scheint jedoch von der Windrichtung abzuhängen.
Unbegreiflich ist folgende Äußerung, die von einem Menschen berichtet wird: »Liebe Frau, ich habe 30 000 Mark in der Lotterie gewonnen, sage aber niemand etwas davon, wir werden sonst in der Steuer erhöht.« – »Mark« sind offenbar die bekannten Götzenbilder, und »Lotterie« soll ein Volksspiel sein, wobei die Veranstalter Belohnungen erhalten. Sonst aber ist alles unklar. Erstens: Liebe Frau! Was ist »liebe« und was ist »Frau«? Ein Weibchen ohne Flügel? Dann aber ist sie doch Mutter und Königin, wie kann sich ein Männchen erdreisten, sie als seine liebe Frau anzureden? Und Steuer – was ist Steuer? Es muß doch wohl ein Übel sein, da der Mensch es vermeiden will. Nach der Erklärung unserer Gelehrten soll aber die Steuer bei den Menschen ein Hauptlebenszweck sein – wie also kann sie ein Übel heißen? Was mich indessen am allermeisten stutzig macht, ist der Ausdruck: »Sage es niemand.« Wie kann man etwas, was ist, nicht sagen wollen? Etwas, was nicht ist, kann doch überhaupt nicht gesagt werden, und was ist, kann durch die Rede nicht anders gemacht werden. Oder sollte es bei den Menschen möglich sein, daß etwas, was für einige ist, für andere nicht sein könnte? Das scheint mir ein unlösbarer Widerspruch.
Mit einigen Führern und 56 Arbeitern auf der Jagd. Da sahen wir denselben Menschen, der uns einmal angegriffen hatte, aber diesmal war noch ein Weibchen bei ihm. Sie schienen sich sehr angelegentlich zu unterhalten. Mehrmals näherte er seinen Fühler dem ihrigen, den sie aber immer wieder zurückzog. Ich bewaffnete mich mit einem Krchschen Sehrohr und einem Hlinzschen Schalltaster und wagte mich bis auf das Haar des Weibchens. Es schien mir von derselben Art zu sein wie die neulich gefundene Haarlocke. Mit Hilfe des Schalltasters hoffte ich ihr Gespräch zu verstehen, aber ich konnte nur so viel wahrnehmen, daß sie mehrmals sagte: »Nein, nein - wir dürfen uns nicht wiedersehen.« Der Mensch ging darauf sehr betrübt fort, gab ihr aber vorher ein Papier, das sie in die Haut steckte oder vielmehr, wie wir jetzt wissen, in die künstliche Haut, welche die Menschen über die Naturhaut ziehen. Als er fort war, fielen einige Tropfen aus ihren Augen, wobei ich in größere Lebensgefahr geriet, weil sie sich über Gesicht und Haar strich. Dann setzte sie sich unter einen Baum und hielt das Papier vor ihre Augen. Endlich ließ sie es in den Schoß sinken und saß lange unbeweglich davor. Nun zwackte ich sie in den Hals. Sie sprang auf, das Papier fiel herab, und der Wind trug es in ein Gebüsch, wo sie es nicht wieder erreichen konnte. Die Arbeiter, welche schon Verstärkung geholt hatten, waren bei der Hand, und 200 Mann schleppten das Papier in den Bau. Wir mußten das Menschenmuseum erweitern. Auf dem Papier stand ein Gedicht, das wir mit Hilfe einiger von der Expedition zurückgekehrter Gelehrter übersetzten. Es heißt darin:
Eine Herrin hab' ich mir erkoren,
Lieb' und Lieder sind ihr zugeschworen!
Ihres Auges Winke sind Befehle
Und ihr Lächeln Sonnentrost der Seele.
Worte, die von ihren Lippen schweben,
Müssen weiter mir im Herzen leben.
Wie ich tief sie hege im Gemüte,
Sproßt daraus des Liedes zarte Blüte.
Und von ihrer Nähe Licht getroffen
Wagt es sich hervor zu frohem Hoffen.
Eine Herrin hab' ich mir erkoren,
Lieb' und Lieder sind ihr zugeschworen!
Es ist gewiß merkwürdig, daß ein so rohes Tier wie der Mensch überhaupt derartige Kunstleistungen zustande bringt. Aber einen Sinn kann man freilich nicht darin finden. Erstens ist es schon Unsinn, daß ein Führer – und ein solcher muß doch der Mensch sein, denn gewöhnliche Männchen und Arbeiter können nicht Verse machen - daß ein Führer von einem Weibchen sich etwas befehlen lassen sollte. Und dann, was ist überhaupt Liebe? Ein Wort, mit dem die Menschen gern umherwerfen, aber ich glaube nicht, daß sie sich selbst dabei etwas denken. Wir wenigstens verstehen es nicht. Man sorgt für Puppen und Larven und für das Wohl des Staates, aber das ist doch alles selbstverständlich – und Liebe? Das muß wohl einer von den menschlichen Instinkten sein, über die wir, dank unserer Ameisenwürde, erhaben sind.
In der Beherrschung der Sprache und Schrift der Menschen habe ich gute Fortschritte gemacht. Ich versäumte keine Gelegenheit, den Menschen zu studieren, der sich oft in unserer Nähe einfindet.
Je näher ich die Menschen kennenlerne, um so mehr muß ich diese unglücklichen Geschöpfe bedauern. Nur das nehmen sie wahr, worauf sie direkt ihre Sinne richten, und wie eng begrenzt sind diese! Der Erdboden, der Träger alles Weltlebens, verschließt ihnen seine unendlichen Feinheiten, bis zu denen ihre blöden Augen nicht hinabreichen. Und selbst wenn sie es täten, wie wenig könnten sie unterscheiden! Denn all die mannigfaltigen, die schnellsten Kräuselungen des Äthers gehen spurlos an ihren groben Nerven vorüber. Sie fühlen nicht den magnetischen Pulsschlag der Erde, nicht die Kristallisationskraft der Stoffe, nicht die Verwandtschaft der Säfte und die Spannungen der Pflanzenzellen, das Gras hören sie nicht wachsen, und die Musik der sich teilenden Spaltpilze ist ihnen versagt. Nur im betäubenden Tageslicht vermögen sie ihren Pfad zu finden, und achtlos stampft ihr breiter Fuß über die Wunder der Schöpfung. Ihr Kopf ragt hinein in die hohle, gestaltlose Luft, in welcher kein Unterschied und kein Gebilde zu erkennen ist. Welch feine Symbolik der Natur liegt schon hierin, daß der Mensch den Kopf aufgerichtet hält im leeren Nichts, die Ameise aber ihn gesenkt trägt zum lebensvollen Boden, dem Wohnplatze der Uremsenheit. Und während wir hier den Gesetzen des Lebens nach sicherer Leitung folgen, irrt der Mensch, ein beklagenswertes Einzelwesen, in ewiger Unbestimmtheit umher, von schwankenden Instinkten getrieben! Einer ihrer größten Führer hat gesagt: »Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht: der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.« – Wenn dies das Beste ist, was sie haben, so sind sie zu bedauern, denn ich weiß damit keinen Sinn zu verbinden. über mir, und wenn ich auf den höchsten Baum klettere, sehe ich nicht, was sie Sterne nennen; und in mir – ich weiß nur, daß alles so ist, wie es ist. Was bedeutet das Gebot: Es soll sein? Oder sollte es noch etwas geben, was selbst wir nicht zu begreifen vermögen?
Nach langer Pause kehre ich zu meinem Buche zurück.
Was ist Liebe? Die Frage ließ mir keine Ruhe. Immer kehrte sie mir wieder, und immer wieder zerbrach ich mir vergeblich den Kopf. Es schien mir eine Schande für das Ameisengeschlecht, daß es uns nicht gelingen sollte, die von uns abweichenden Eigentümlichkeiten des rohen Menschen kennenzulernen und zu erklären, und da das Problem der Liebe nicht zu den Aufgaben gehörte, welche unserer Expedition ausdrücklich gestellt waren, so trieb mich Wißbegier und – gesteh' ich's nur, obwohl dies fast nach menschlicher Ansteckung aussieht – auch eine Art von Ehrgeiz, die Lösung der Frage auf eigene Gefahr zu versuchen. Es war ein Leichtsinn! Mit Schaudern denke ich an die Tage zurück, welche ich verleben mußte – ein Wunder, daß ich sie überleben konnte!
Ich begab mich so oft wie möglich an die Stelle, an welcher wir die Menschen beobachtet und das Gedicht erobert hatten. Fast jeden Tag sah ich den Menschen dort auf einem Baumstamm sitzen und über das Wasser des kleinen Teiches hinweg in die Ferne schauen, ohne daß ich irgendeinen Gegenstand entdecken konnte, welcher der Aufmerksamkeit eines Menschen mir wert schien. Endlich, es war an der zweiten Beutesonne, fast der ganze Stock war auf dem Kriegspfade, und ich saß wieder über dem Menschen an dem alten Platze – endlich bemerkte ich auf dem Menschenwege am andern Ufer des Wassers jenes Weibchen, aber nicht allein, sondern in Gesellschaft eines älteren, wie ich an dem langsamen Gange bemerkte. Der Mensch sprang auf, aber sogleich setzte er sich erschrocken wieder hin und verbarg sich hinter dem Laubwerk. Lange blieb er so, den Kopf in die Hand gestützt, traurig sitzen. Sonst war er so schnell und freudig dem Weibchen – ein Mädchen nennen es die Menschen – entgegengegangen, und jetzt versteckte er sich? Es war mir unerklärlich. Er zog seine Schreibtafel hervor. Ich näherte mich unbemerkt, und da ich jetzt die nötige Übung im Übertasten der Menschenschrift besitze, gelang es mir, was er sehr langsam und in Pausen niederschrieb, zu verstehen. Es lautete:
Nach dem Wege späh' ich am Weiher drüben,
Ob du kommst, Geliebte, herabzuwandeln –
Ach, zu tief herniedergebeugte Zweige
Hemmen den Blick mir!
Aber sieh, von rosigem Lichte schimmert
Dort im Uferschatten die leichte Welle,
Von den Strahlen deines Gewands getroffen
Hold dich verratend.
Ach warum, warum nur im Wiederscheine
Darf ich deine süße Gestalt erblicken?
Ach warum, du Liebliche, soll ich niemals
Selbst dir begegnen?
Ewig scheidet neidisch die dunkle Fläche
Voneinander uns die ersehnten Wege,
Und herüber zittert nur deines schwanken
Bildes Erscheinung.
Ja, warum denn? Er brauchte doch nur um den Teich herumzugehen. – Wie dumm doch die Menschen sind! Ich beschloß, das Äußerste zu wagen, um dieses Warum zu ergründen. Der Mensch schickte sich an fortzugehen. Ich begab mich auf ihn, ich ließ mich von ihm tragen – ins Fremde, ins Ungewisse, wahrscheinlich in den Tod! Aber ich wollte es wissen: Was ist Liebe?
Der Weg war weit, wir hätten auf eigenen Füßen wohl eine Tageswanderung gebraucht. Da blieb der Mensch so plötzlich stehen, daß ich fast herabgefallen wäre. Und ebenso plötzlich setzte er seinen Weg fort. Die beiden Weibchen kamen ihm entgegen. Nun hatte er ja seinen Wunsch erreicht, jetzt konnte er wie früher mit ihr reden. Und ich erwartete, daß sie ihm entgegenspringen werde. Aber was geschah? Sie sah ihn gar nicht an, er hob schweigend den Arm nach dem Kopfe – ich verlor das Gleichgewicht und flog durch die Luft. Als ich wieder zur Besinnung kam, was eigentlich mit mir geschehen sei, waren beide, der Mensch und die beiden Weibchen, schon ein Stück voneinander entfernt, und bald verlor ich den Menschen aus dem Gesicht. Ich saß nämlich, wie ich jetzt bemerkte, in dem Gewande des Mädchens. Hier hielt ich mich verborgen, ich weiß nicht, wie lange.
Eine plötzliche starke Erschütterung des Kleides warf mich auf den Boden. Als ich imstande war, mich umzusehen, fand ich mich in einer Menschenwohnung. Das Weibchen war allein, aber sie hatte jetzt ein weißes Gewand an. Es war dunkel im Zimmer, nur auf dem Tische, an welchem das Weibchen saß, leuchtete eine helle Flamme. Ich sah mich in meinem Schrecken zunächst nach einem Zufluchtsort um, dann aber besann ich mich meiner Aufgabe und wanderte mutig dem Lichte entgegen. Auf dem Tische angelangt, verbarg ich mich in einem dort stehenden Blumenstrauße und konnte nun das Weibchen genau beobachten. Sie hielt ein Bild – die Menschen ahmen merkwürdig geschickt alles nach, was sie sehen – in ihrer Hand; einige Blätter Papier, in denen sie eben gelesen, lagen neben ihr. Jch hatte später — leider! — Gelegenheit, den Jnhalt genau zu vermerken und will ihn sogleich hier verzeichnen unter der Überschrift:
Ja, ich bin glücklich, wenn ich dich gesehn,
Wenn ich ein Lächeln, einen Blick gewonnen!
Beseligt kann ich meines Weges gehn,
Wo ich auch wandle, strahlen milde Sonnen.
Die milden Sonnen sind die Augen dein,
Sie leuchten mir ins Schattenreich des Lebens.
So lang' ich atmen darf in ihrem Schein,
So lange, weiß ich, leb' ich nicht vergebens.
Ja, ich bin glücklich, wenn ich dich gesehn!
Du bist der stille Segen meiner Tage;
Denn alles Glück ist mir durch dich geschehn,
Seit ich dein Bild im tiefsten Herzen trage.
* * * * *
Unbegriffen, wie die Welt
Sich erfüllt in eignem Weben,
Hat sich wundersam gesellt
Ein Gedanke meinem Leben.
Daß ich nimmermehr mein Sein
Von dem deinen weiß zu scheiden,
Daß ich dein und daß du mein,
Und daß alles ist uns Beiden.
Daß ich dein gedenken muß,
Ob ich nahe dir, ob ferne,
Und daß meiner Sehnsucht Kuß
Ewig weilt bei meinem Sterne.
* * * * *
Wenn ich dein gedenke,
Wird die Welt mir fern,
Meine Seele schwebet
Über Raum und Stern.
Wenn ich dich erblicke,
Wird mir heiß zu Sinn,
Unruhvolles Treiben
Drängt nach dir mich hin.
Wenn ich leise rühre
Hand an deine Hand,
Ach, in sel'ger Enge
Haft' ich festgebannt.
* * * * *
Du siehst mich leben, siehst mich ruhig wandeln
Die ausgetretnen Gleise meiner Tage.
Ja, ich kann lächeln, kann verständig handeln
Und vorwärtsschreiten — das ist keine Frage.
Doch dir ins Ohr muß ich es anvertrauen:
Ich bin's nicht mehr, nicht Ich, der sich gestaltet!
Ein Schatten ist's, ich fühl's mit tiefem Grauen,
Der seelenlos an meiner Stelle waltet.
Die Seele floh, und dich hat sie erkoren,
An deinen Augen hängt sie, deinem Munde!
Gieb sie zurück! Doch nein, sie sei verloren —
Gieb deine Seele mir, daß ich gesunde!
* * * * *
Ich weiß es nicht, wo die Geliebte weilt
Und was sie schafft mit den geweihten Händen,
Wer ihres Wandels holde Nähe teilt,
Wem ihre Augen, ach, mein Glück verschwenden!
Ob sie in Sorgen wacht, ich weiß es nicht,
Ob sie das schöne Haupt geneigt zum Schlummer —
Vielleicht, o Gott, gebeugt der strengen Pflicht
Muß jetzt sie lächeln unter ihrem Kummer.
Doch weiß ich Eins: Mit ihrem Schmerz allein
Wildschluchzend bebt sie auf in heißem Sehnen —
Ich weiß, auch sie — auch sie gedenket mein
Und heimlich trocknet sie die stillen Thränen.
* * * * *
Es ist mein Stern aus seiner Bahn gegangen
Und seiner Pole Umsturz ward vollbracht.
Nun wandel' ich am Tage traumbefangen
Und grübelnd bang durchwach' ich meine Nacht.
Ich blick' empor, und meine Sinne irren
Befremdet in der dunkeln Welt umher.
Sind es nur Nebel, die den Weg mir wirren,
Sperrt ewig ihn das abgrundtiefe Meer?
Noch glüht ein Schimmer mir aus Wolken nieder,
Ein ferner Hoffnungsstrahl, der sie durchbricht.
O raub' ihn nicht! Gieb mir das Leben wieder!
Geliebte Sonne, gönne mir dein Licht!
Das Bild war ihrer Hand entfallennn. Mit Erstaunen sah ich, daß es den Menschen darstellte, an welchem sie heute so kalt vorübergegangen war. Und jetzt – unbegreiflich – erfaßte sie es und drückte ihre Lippen darauf, gerade wie es der Mensch mit jener Haarlocke gemacht. Ich weiß jetzt, daß dies das Zeichen der höchsten Billigung bei den Menschen ist, wie aber ist es erklärlich, daß sie dies bei dem Menschen tat, den sie eben so schlecht behandelt hatte? Dabei rannen Tropfen aus ihren Augen. jetzt begann sie selbst zu schreiben. Auch ihre Zeilen hatte ich Zeit genau zu studieren:
Lieber teurer Freund!
Freuen Sie sich nicht, daß Sie einen Brief von mir erhalten, er wird Ihnen eine Enttäuschung bringen, aber es muß sein. Es ist mir klargeworden, ich kann das Leben nicht mehr ertragen, das ich führe, es ist ein Leben der Lüge. Ich betrüge meine Eltern, ich betrüge die Ihrigen, und so lebe ich in einer ewigen Furcht vor Entdeckung. Schon ist meine Mutter mißtrauisch geworden, ich habe Sie deswegen gemieden – so schwer es mir wurde. Es muß noch Schwereres geschehen, ich darf Sie nicht wiedersehen. Ich weiß keinen andern Weg. Eine Entdeckung wäre mir entsetzlich, und wir würden dann unter Schimpf und Schande getrennt. Das wird Ihre Liebe mir nicht zumuten wollen. Darum trennen wir uns freiwillig. Denn der andere Weg, daß wir den Unsern unsere Liebe bekennen, daß wir alles auf uns nehmen und der Welt um unserer Liebe willen trotzen, der ist uns verschlossen. Nie wird mein Stolz gestatten, daß Sie um meinetwillen die glänzende Laufbahn aufgeben, zu der Sie bestimmt sind, daß Sie die Pflichten versäumen, welche Sie dem Leben schulden, daß Sie alle Schranken durchbrechen, uni im.Kampfe mit Not und Elend sich ein neues Dasein zu gründen – und anders wäre es nicht möglich, das wissen Sie. Und daß ich auch die Meinigen für immer verlieren würde, wenn ich Ihnen, dem Fremden, dem Andersgläubigen, folgte.
Nein, es kann nicht sein, und Sie selbst könnten es nicht, wenn Sie auch wollten. Ihre Liebe ist nicht für die Ewigkeit. Sie werden Lydia bald vergessen. Ich weiß, die Zeit ist nicht fern, in welcher ein anderes Bild das meinige aus Ihrem Herzen verdrängt. – Werden Sie glücklich, es ist besser so.
Ich weiß, wie schuldig ich bin, ich durfte Sie nicht anhören, wenn Sie so lieb sprachen – aber Gott weiß, in Ihrer Nähe hatte ich alles vergessen, was ich sagen wollte und mußte. Verzeihen Sie mir. Nie werde ich wieder gegen einen Mann freundlich sein, das sei meine Buße. Ich liebe Sie, ich will Sie lieben wie einen Freund und Bruder und Ihnen mein Leben lang danken für die glücklichen, unendlich glücklichen Stunden Ihrer Liebe. jetzt sind wir frei, eine Zentnerlast fällt mir vom Herzen, da ich es Ihnen gesagt habe.
Schreiben Sie mir nicht wieder, an meinem Entschlusse können Sie nichts ändern, es könnte nur zu einer Entdeckung führen.
Lydia
Ich dachte immer, Liebe sei der Instinkt, wodurch man etwas allem anderen vorzieht; nun sah ich, daß Liebe die Menschen voneinandertreibt. Das verstehe, wer kann! – In meinem Forschungseifer hatte ich mich auf den Tisch gewagt, während Lydia – das ist so ein Menschenname, den man gar nicht aussprechen kann – den Brief zusammenfaltete. In diesem Augenblicke ging die Tür auf. Lydia hatte kaum Zeit, die Papiere und das Bild zusammenzuraffen und in ein Schränkchen zu verschließen, das zu dem Tische gehörte. Das alte Weibchen war hereingekommen. Dies war, wie ich bald erfuhr, Lydias »Mutter«; bei den Menschen hat nämlich jeder seine eigene »Mutter« – ein mir nicht ganz klarer Begriff. Sie war ungehalten, daß Lydia noch schrieb, und fragte, was sie da so eilig verberge? Sie griff nach einem Blatte, das liegengeblieben war, aber jetzt erblickte sie mich, und mit dem Ausrufe: »Eine Ameise! Ich kann die Tiere in den Tod nicht leiden!« schlug sie nach mir. Ich entfloh unter das Schreibzeug, sie rückte es fort, sie jagte mich weiter, endlich aber gelang es mir, mich zu verbergen, und wie'ich aus meinem Versteck bemerkte, hatte Lydia inzwischen auch das letzte Blättchen gerettet. Wieder ein Beispiel von der Eigentümlichkeit der Menschen, sich gegenseitig manches zu verbergen!
Das Licht war verschwunden. Ich konnte mich nach kurzer Ruhe hervorwagen und meine Entdeckungsreise beginnen, denn im Finstern sehen die Menschen nichts. Mein Ziel war das Schränkchen, in das ich durch das Schlüsselloch eindrang. Ich fand Kästchen mit Schmucksachen, vertrocknete Blumen, Papiere und Briefe, und ich nahm mir vor, hier eingehende Studien zu treiben. Wenn irgendwo, so mußte hier zu entdecken sein, was Liebe ist, denn Lydia schien dies ja genau zu wissen.
Vergebens sah ich mich nach Lebensmitteln um. Mich hungerte, und ich verließ wieder das Schränkchen. Weite Wanderungen legte ich unter Entbehrungen und Gefahren zurück, ich fühlte mich einsam und beklagte meinen Fürwitz. Schon nahte der Tag, und ich mußte daran denken, mich zu verbergen. Da – ich atmete auf – spürte ich die Nähe von Honig. Ich drang durch die Ritze eines Schrankes, ich fand einen großen Vorrat – aber andere Ameisen waren bereits dabei! Sie stürzten auf mich zu - ich war verloren oder wenigstens zum Sklaven gemacht! Ich wollte tapfer sterben und rüstete mich zum Kampfe. Den ersten packte ich mit den Zangen, da berührten ihn meine Fühler, und – ich erkannte Rlf! Es war unser eigener Stamm, unsre Expedition, die hier ihr Vorratslager hatte. Im Triumphe führten sie mich in.ihr Versteck unter den Dielen. Sie erzählten von ihren Entdeckungen, sie zeigten mir die große Anzahl übertasteter Keulenkäferchen, eine glänzende Bibliothek, aber vor allem hatte ich das Bedürfnis, nach Nahrung und Ruhe. Beides wurde mir zuteil.
In der nächsten Nacht führte ich eine Abteilung unserer Expedition mit den nötigen Keulenkäferchen in Lydias Geheimfach, um die Akten der Liebe zu durchstöbern und aufzunehmen. Wir begannen zu übersetzen und zu übertasten. In unserm Eifer bemerkten wir nicht, daß draußen der Tag längst angebrochen war, als wir durch die laute Stimme der Mutter aufmerksam gemacht wurden. Noch hofften wir verborgen bleiben zu können. Wir lauschten mit unsern Ferntastern. Sie stritt mit Lydia und verlangte von ihr den Schlüssel des Schränkchens. Plötzlich wurden wir vom hellen Tageslicht geblendet, das durch die geöffnete Tür schien.
Die Mutter guckte herein, aber ehe wir uns retten konnten, schlug sie die Tür wieder zu und schrie: »Wieder Ameisen! Ein ganzes Nest! Und über den Honig sind sie auch gegangen. Wo ist der Spiritus? Wir wollen Sie hineintun, Ameisenspiritus ist so gut gegen Rheumatismus. Ich will nur ein Töpfchen holen.«
Ameisenspiritus! Entsetzlich! Was wollte man mit uns? Zerquetschen? Ertränken? Und nirgends eine Rettung? Wir kletterten zum Schlüsselloch; es war unzugänglich, der Schlüssel steckte darin - kaum ein Keulenkäferchen hätte sich durchdrängen können. Nirgends ein Spalt, eine Ritze, überall die glatte Politur – wir rannten ohne Überlegung umher. Da öffnet sich noch einmal die Tür auf einen Moment, Lydias Hand greift hinein und erfaßt das Päckchen Papier, das sie schnell in ihre Tasche gleiten läßt. Einige von den unsern werden dabei hinausgeschleudert und vernichtet. Die Tür ist wieder geschlossen. Wir hören die Alte zurückkommen, sie ruft nach dem Spiritus – da, beim Herausreißen der Papiere hat sich der Deckel eines Pappkästchens verschoben, wir kriechen durch den schmalen Spalt. Auf Watte lag ein großer gewundener Wurm von blankem Stoffe, wie ihn die Menschen am Arme tragen. Am Kopf hatte er zwei Augen, in dem einen saß ein roter Stein, das andere war leer. Inwendig war der Wurm oder die Schlange hohl – hier konnten wir uns verbergen! Führer, Arbeiter und Keulenkäferchen, alle brachten wir in den Windungen des Armbands unter. Wir hörten die Mutter schelten – weder die Ameisen noch die Papiere fand sie!
Es folgten die furchtbarsten Tage meines Lebens. Der Schrank blieb verschlossen, aber auch das Schlüsselloch. Es war uns unmöglich, zu entfliehen. Wenn Geräusch entstand, verbargen wir uns in dem Armband. Hier saßen wir zusammengedrängt, vom Hunger erschöpft. Nach einer solchen Flucht fanden wir die Papiere wieder im Schranke vor, wir studierten sie weiter trotz unseres erbarmungswürdigen Zustandes. Der Schlüssel war auch wieder abgezogen, aber es war ein anderer fester Gegenstand vorgeschoben, den wir nicht beseitigen konnten. Noch immer keine Aussicht auf Rettung! Wir versuchten das Papier zu verzehren. aber es bekam uns nicht.
Beutesonne 17 starben der Führer Mrs und fünf Arbeiter. Die Käfer sind noch wohlauf. Beutesonne 18 verloren wir einen Führer und zehn Arbeiter. Wir hatten beschlossen, einen Rettungsversuch zu unternehmen. Sich beim Öffnen der Tür hinauszuwagen wäre direktes Verderben gewesen. Wir hatten jedoch bemerkt, daß, wenn die Tür aufging, an der Seite, wo sie sich drehte, ein schmaler Spalt entstand. Ein Führer und zehn Arbeiter sollten bei der nächsten Öffnung des Schrankes den Versuch machen, sich hier hinauszuschleichen. Gelang das Wagnis, so sollten die übrigen es später ebenfalls versuchen. Sie warteten an der passenden Stelle, aber – als die Tür aufging, wurden sie zu unserm Entsetzen durch die einwärts tretende Kante grausam zermalmt! Wir waren in Verzweiflung. Hoffnungslos untersuchten wir, was in den Schrank gelegt worden – neue Papiere. Was nutzten sie uns jetzt? Aber da, ein Päckchen, süß duftend – wir zernagten das Papier –, eine dunkle, süße Masse – wir kannten sie nicht, aber sie schmeckte herrlich! Wir waren vorläufig vor dem Hungertode gerettet! Mit erneuter Kraft ging ich an die Übersetzung der Papiere. Der Inhalt lautet:
O rede nicht mir von Verstand und Pflicht!
Wer hat der Liebe dunkles Reich ermessen,
Wo Wunsch und That sich selber widerspricht?
Ich kann es nicht, und will nicht dein vergessen!
Um einen Preis nur stand ich still zurück, —
Um deinen Frieden konnt' ich von dir lassen.
Doch gönn' ich die Geliebte nur dem Glück,
Und was dich elend macht, das muß ich hassen.
Ertragen will ich, was dein Wink befiehlt,
So lang' dein Lächeln leuchtet durch die Tage;
Wenn sich die Thräne dir vom Auge stiehlt,
Wie wär' es möglich, daß ich dir entsage?
* * * * *
Sind die Tage nicht verronnen,
Sind die Rosen nicht verblüht,
Seit aus deiner Augen Sonnen
Mir der letzte Strahl geglüht?
Seit dein Wort zum letzten Male
Vom geliebten Mund getönt,
Nicht mehr an die erz'ne Schale
Hat der Stunden Schlag gedröhnt.
In ein ew'ges Jetzt erstarret
Ist der flüchtige Moment,
Und der dumpfe Schmerz verharret,
Und die Sehnsucht wühlt und brennt.
Mich vom Erdentod zu retten
Hast du mich der Zeit entrückt,
Und der Sinne Sklavenketten
Liegen machtlos und zerstückt.
Ob der Weltenlauf verronnen,
Ob der Sternenglanz versprüht,
Raumlos über allen Sonnen,
Zeitlos meine Liebe glüht.
Und hierunter stand von derselben Hand:
»Wie diese Blätter, so werde auch ich den Weg zu Dir finden, trotz alledem! Dein für immer.«
Der Schlüssel klirrte, wir flohen in das Armband. Aber, o Schrecken! Die Schachtel wird geöffnet – wir verbergen uns in der äußersten Windung –, das Armband wird emporgehoben, Lydia hat es angelegt! Wir halten uns fest zusammen. Langsam verrinnt die Zeit, schwer werden wir durcheinandergeschüttelt, aber frische Luft dringt durch das Schlangenauge – Waldluft! Die Erschütterungen hören endlich auf – alles ruhig. Ich wage mich als Kundschafter hinaus – wir sind am Weiher! Lydia sitzt ruhig da – vielleicht können wir entfliehen; ich winke den Genossen. Da nahen Schritte, es ist jener Mensch! Lydia erblickt ihn, sie springt auf und schreitet eilig nach der anderen Seite, sie flieht ihn, und er wendet sich mit finsterem Blicke zum Gehen.
Da – ein Schrei –, Lydia schleudert das Armband von sich – der unvorsichtige Rlf hat die Genossen hinausgeführt, sie wollten entfliehen, aber bei der ersten Berührung ihres Armes bemerkt Lydia, daß sie aus dem Armband hervorquellen –, das goldne Gefängnis mit der ganzen Expedition liegt im Grase. Ich sehe noch Lydia wie versteinert stehen und auf ihren Arm starren, ich sehe den Menschen umkehren und sich ihr nähern, er fragt, ob sie verletzt sei, er ergreift ihre Hand, er blickt auf den Arm, er drückt ihn an seine Lippen – nun endlich scheint sie sich zu besinnen, daß sie fliehen wollte. – Die Genossen sind schon auf der Wanderung nach dem Stock, ich allein hafte in Lydias Gewande, ich kann mich nicht entschließen zu fliehen, bis ich gehört habe –
»Vertrau mir«, sagte er. »Ich bin dein, werde dein fürs Leben. Ich habe es durchgesetzt, mich von allen Schranken zu lösen. Ein bescheidenes Los, aber ein freies. Was ist mir die Welt ohne dich? Du bist mein Glück, meine Hoffnung, nur in deiner Liebe finde ich meine Kraft. Ich werde dich erringen, fürchte nichts!« Sie schweigt, sie weint. »Ich kann ja nicht anders«, flüsterte sie endlich. »Ich habe gerungen gegen dich, gegen mich – ich war zu schwach. Nun komme, was da wolle. Ich kenne nichts mehr als deine Liebe!« Er sank zu ihren Füßen, ich fiel zu Boden. Ich mußte den Genossen folgen.
Aber was ist Liebe? Ich habe es nicht erfahren. Das höchste Glück und das höchste Elend der Menschen? Sie werfen es fort, und dann vergessen sie alles um der Liebe willen? Den ganzen Staat für einen Menschen, die Welt um ein Weibchen? Unglückseliges, bedauernswertes Geschlecht! Wie weise sind doch die Einrichtungen der Ameisen! Wie herrlich das »Unbewußtsein der unvermeidlichen Handlungsweise!« – Morgen ist die erste Hochzeitssonne. So ist es ein Jahr wie das andere, und das ist gut so.
Wieder ordentlich im Stock eingerichtet. Mögen die Menschen machen, was sie wollen, ich habe höhere Pflichten, als mich um den Unsinn zu kümmern, den sie Liebe nennen. Bei uns läuft alles im Stock durcheinander. Es ist Zeit, daß die unnützen Esser, die Männchen, beseitigt werden.
Am nächsten schönen Sonnentage, den wir haben, wird das Hochzeitsfest gefeiert. Es ist eigentlich schade, daß mein guter Freund Klx ein Männchen ist. in wenigen Tagen ist es mit ihm vorbei. Wäre er als Führer ausgekrochen, so hätte etwas aus ihm werden können; für ein Männchen macht er sich viel zuviel Gedanken. Es scheint wirklich, als wären wir alle schon ein wenig angesteckt von der Zerfahrenheit und Unbefriedigung der Menschen. So fragte mich Klx, warum er nach der Hochzeit sterben müsse. Dumme Frage! Weil er dann nichts mehr nutze ist. Gewiß hat er einmal etwas von dem sogenannten Selbstzweck gehört, auf den sich die Menschen etwas einbilden. Und was dann aus ihm würde? Ob es wahr wäre, daß er in die Erde komme, in den großen Ameisenstock, wo es nur Führer gibt und keinen Winter? Und ob im nächsten Jahr und dann wieder es Männchen geben würde? Und ob hinter dem Walde noch andere Wälder und darin Ameisen und immer wieder Ameisen wären? Und warum es so viele gebe, wenn sie doch nie miteinander Krieg führen und Puppen erbeuten könnten? Es sei oft ein seltsames Gefühl in ihm, wenn er daran denke, daß alles dies wäre und geschähe und vorwärtsginge, gleichviel, ob er davon wisse oder nicht, und daß es so gar nicht auf ihn ankäme und er doch seine Flügel und Fühler habe und seines Lebens sich freue. Ich sagte ihm, das fühle freilich, ein jeder, aber man dürfe davon nicht reden, weil sich durch keine Worte sagen lasse, was das Ameisenherz in sich erlebt, und wenn er es andern übertasten wolle, so werde es etwas ganz andres werden, als er in sich fühle, und es entstünde flaches Gered' und eitel Gezänk, und zuletzt zwackte man sich die Fühler ab. Dann wollte er gar wissen, ob bei den Menschen die Männchen auch nach der Hochzeit stürben – da hieß ich ihn die Taster halten, von den Menschen brauchte er überhaupt nichts zu wissen, denn das sei eine Sache der Bildung, die nur die Führer anginge. Und damit schickte ich ihn fort. Soviel ich weiß, bleiben übrigens bei den Menschen die Männchen leben, sie sollen nur etwas träger werden. Es müssen dort merkwürdige Verhältnisse herrschen. Große Volksfeste haben sie wohl auch, aber an unser Hochzeitsfest dürften sie nicht heranreichen. Gerade die wichtigste soziale Frage scheinen sie als Privatsache zu behandeln. Wunderbar!
Gestern war der große Tag. Die Sonne schien mild und warm. Hochzeitsgetümmel in den Lüften! Selige Ameisenschaft, heute Leben und Wonnesein, und dann ist's vorbei. Die Männchen sind heute fast alle schon dahin, auch unter den Weibchen haben die Vögel tüchtig aufgeräumt. Die übriggebliebenen haben wir zum größten Teile bereits in die Winterzellen gebracht. Für die Zukunft des Stockes ist gesorgt, und nun mag das Jahr zu Ende gehen.
Endlich ist der Rest der Expedition von den Menschen zurückgekehrt, Tausende von eingetasteten Käfern führen sie mit sich, wir müssen unsere Bibliotheksräume durch einen Anbau erweitern. Unsere Gelehrten haben mehrere Menschenbücher übersetzt, ich habe schon viel darin gelesen, aber wenig verstanden. Vielen Menschen soll es auch so gehen. Was sich die Menschen einbilden! Sie nennen sich die Herren der Schöpfung und wissen nicht, daß sie nur aus der Erde gewachsen sind, damit wir an ihnen unsern Verstand üben und unsern Geist unterhalten. Denn sonst wüßte ich nicht, was sie eigentlich nützten.
Die Abrechnung über unsere Eroberungszüge ist beendet. Das Jahr war ein mittelmäßiges, viel Verluste, aber auch reichliche Sklaveneinfuhr, dagegen wenig Puppen erbeutet. In mein Tagebuch schreibe ich nichts von den Kriegsgeschäften, es lohnt sich nicht. Die Menschen machen von ihren Kriegen furchtbar viel her, das kommt aber daher, weil sie dieselben gegen ihre Freunde und nicht gegen ihre Feinde führen. Denn von den Feinden heißt es ausdrücklich, daß sie sie lieben sollen. Aber da ist wieder das unverständliche Wort!
Heute noch einmal im Freien, vielleicht zum letzten Male. Das Laub fällt von den Bäumen, und die Herbstspinnen fahren durch die Luft. Wir sahen unsern Menschen wieder, und das Weibchen war bei ihm. Sie schienen sehr befreundet, denn sie streichelten und liebkosten sich – dabei sprachen sie in großer Furcht davon, daß andere Menschen sie sehen könnten. Er fragt:
Durch wirbelude Blätter schritt ich dahin —
Was raunte der Wind mir ins Ohr?
»Du findest ihn nimmer, den süßen Gewinn,
Was suchst du, irrender Thor?
Verweht die Wege, entfärbt die Flur,
Grauwallende Nebel verhüllen die Spur,
Und ferne der Lenz und das Licht —
Die Blumen, sie blühen dir nicht!«
»Du wirbelndes Laub, du sausender Wind,
Mir habt ihr vergebens gedroht!
Nun bin ich getrost, nun schreit' ich geschwind,
Enthoben der quälenden Not.
Den Schleier durchbrach ein himmlisches Blau,
Mich grüßten die Augen der holdesten Frau.
Und Wangen, die rosig erglüht!
Die Blumen, sie sind mir erblüht!«
Warum nur die andern Menschen davon nichts wissen sollten? Das Unaussprechliche verhandeln sie vor dem Volke in großen Versammlungen, und das, wovon doch das Gedeihen des Stockes abhängt, scheuen sie sich zu besprechen, und nur in der Einsamkeit wagen sie ihre Liebkosungen. Trotz aller Ameisenähnlichkeit – sie bleiben doch immer bloß Menschen!
Es ist kalt geworden. Die Eingänge zum Stock sind verschlossen und verstopft. Heut haben wir den letzten Weibchen die Flügel abgenommen und sie in ihre Zellen gesteckt. Nun haben wir Ruhe!
Ich las in der Bibliothek in einem Menschenbuche eine seltsame Geschichte, die ich nicht glauben kann. Es war ein Mensch, wahrscheinlich ein Führer, der mehr wußte als die andern,und ihnen das alles sagte, weil er glaubte, daß es gut sein würde für den Stock; und das finde ich ganz selbstverständlich. Den andern Führern aber gefiel es nicht, weil er auch zu den Sklaven sprach, daß sie nicht geringer seien als die Führer. Da nahmen sie ihn und sagten, wenn er nicht seine Taster still halte, so würden sie ihn totzwacken. Das ist ja auch ganz richtig, denn wer den Führern und damit dem Stock schadet, muß totgezwackt werden. Nun aber kommt das, was ich nicht verstehe. Der Mensch wurde nicht etwa still, sondern er fuhr fort, seine Meinung zu behalten und zu behaupten. Wie kann das sein, daß einer von der Meinung der Führer abweicht? Und wie sie ihn nun zwackten, so hörte er doch nicht auf zu reden, sondern er hob seine Taster vor allem Volke und rief: »Ihr könnt nicht richten über mein Gewissen, das mich heißt die Wahrheit zu künden. Höher als das Leben steht die Freiheit der Überzeugung. Totzwacken könnt ihr mich wohl, aber meine Worte werden bleiben, und ich sterbe gern für die Freiheit! «
Was soll das alles heißen? Freiheit? Dummes Zeug! Ich krieche in meine Winterzelle.
Die neun Musen saßen einmal bei einem gemütlichen Kaffee in Klios Salon und amüsierten sich so gut, daß es ihnen leid tat, keine Hausschlüssel mitzuhaben. Sie beschlossen aber, recht bald wieder zusammenzukommen und dann gleich zum Tee zu bleiben.
Ja, eine Abendgesellschaft sollte es sein, aber eine recht splendide, und man könnte vielleicht auch noch den oder jenen dazu laden, nur nicht die Grazien, weil sie zu geziert sind, und auch nicht die Parzen, sie sind, so griesgrämig, und beileibe nicht die Horen, denn mit so flüchtigen Personen darf eine ruhige und gesittete Muse gar nicht umgehen. Von den höheren Göttinnen kann natürlich nicht die Rede sein; diese olympischen Damen machen Ansprüche, welche in unserer Zeit nicht mehr passen, und bilden sich ein, etwas Besonderes vorzustellen. Und die Nymphen und Nereiden und so weiter, das hat denn doch einen zu niedrigen Bildungsstandpunkt, als daß unsereiner sich mit ihnen unterhalten könnte.
»Aber so laden wir doch Herren ein«, sagte Terpsichore, »dann wird der Abend sicher noch einmal so nett.«
»Wo denken Sie hin?« erwiderte Urania stirnrunzelnd. »Unsere Herren sind noch viel arroganter als unsere Göttinnen mit Frau Hera an der Spitze.«
»Ich meine natürlich nicht die Herren Götter!«
»Nun doch nicht etwa die Heroen, die nichts können als zuhauen und Drachen totschlagen?«
»Nein, aber wie wäre es mit den Menschen?«
»Ach, die Menschen!« seufzte Erato.
»Sie sollen sehr dumm sein«, bemerkte Kalliope, worüber die anderen lächelten; denn Kalliope galt ihnen in dieser Beziehung als etwas menschlich.
»An der Dummheit der Menschen«, begann Klio, »ist allerdings leider im allgemeinen nicht zu zweifeln, doch gibt es auch Ausnahmen; denn wie könnte man sonst von den Sieben Weisen Griechenlands sprechen?«
»Wahrhaftig«, rief Melpomene, »so laden wir doch die Weisen von Hellas ein! Können wir uns bessere Gesellschaft wünschen?«
»Es sind nur sieben«, wendete Erato ein.
»Wir verzichten auf einen Herrn!« riefen Klio und Urania wie aus einem Munde. Die übrigen nickten dazu, sie fanden das ganz natürlich, und aus Höflichkeit sagten sie weiter nichts.
So wurde denn beschlossen, die Sieben Weisen Griechenlands zum Tee mit Abendbrot einzuladen, und es ergab sich nur noch eine kleine Schwierigkeit – wie nämlich die Einladungen zu bestellen seien. Zum Unglück zeigte es sich, daß keine der Musen die Namen der Sieben Weisen kannte. Einzelne hatten sie zwar in der Töchterschule gelernt, aber das war schon einige Jahre her, und man kann nicht alles behalten. Selbst Klio und Urania, welche doch das Seminar besucht und das Examen gemacht hatten, konnten sich nicht mehr mit Sicherheit erinnern. Da fiel Klio ein, daß sie einmal bei Tante Mnemosyne von einem Mnernotechniker einen Merkspruch gehört hatte, durch den man unweigerlich die Namen der Sieben Weisen behalten mußte. Ja, wenn sie nur den Merkspruch nicht vergessen hätte! Aber er stand ja in ihrem Notizbuche, da konnte sie ihn auffinden. Der Spruch lautete folgendermaßen: » Solon steht mit einem Fuße auf Chili, mit dem andern auf Peru, sieht in ein Tal voll Klee und trinkt Bitter-Bier.«
»Wie geistreich!« sagte Kalliope.
»Ja, ja«, bestätigte Polyhymnia, »die Mnemonik hat Geschmack, das muß man sagen, dafür wurde sie auch von meinem Liebling Simonides erfunden.«
»Aber wie heißen denn nun die Sieben Weisen?« fragte die naive Erato.
»Der erste heißt Solon«, sagte Klio.
»So klug bin ich auch! Und der zweite Chili, nicht wahr?«
»Bewahre, das gehört ja in die neuere Geschichte! Ich will Ihnen den Spruch erklären, meine Damen. Chili bedeutet Chilon, Peru Periander, Tal Thales, Klee Kleobulos und Bitter-Bier Pittakus und Bias.«
»Aber warum heißt es denn dann nicht Pitter-Bier?«
»Das weiß ich nicht«, entgegnete Klio ungehalten, »fragen Sie Herrn Simonides. übrigens können Sie es aussprechen, wie Sie wollen.«
Die Einladungskarten wurden geschrieben und sollten eben abgeschickt werden, als sich herausstellte, daß sie gar nicht mehr zur rechten Zeit durch die olympische Post befördert werden konnten. Und d ies kam von der strengen Feiertagsheiligung, welche in den olympischen Kreisen selbstverständlich eingeführt war. Nun war aber jeder der sieben Wochentage einem Gott oder einer Göttin geweiht, und infolgedessen durfte an demselben nicht gearbeitet werden; das war eben das Angenehme im Olymp, daß man es gar nicht nötig hatte, sich abzuhetzen. Die Post ging also, strenggenommen, gar nicht, ausnahmsweise jedoch des Mittwochs, weil dieser Tag dem Hermes geheiligt war; da ging sie manchmal zum Vergnügen. Die Musen hatten ihren Beschluß des Donnerstags gefaßt, und am Samstag sollte die Gesellschaft sein.
Sie entschlossen sich also kurz und nahmen sich einen alten Lohndiener, welcher früher bei Hermes Briefbote gewesen war und daher die Adressen gut kannte. Dem sagten sie, er solle die Einladungen mündlich bestellen: »Die Herren Weisen Griechenlands möchten den Musen die Ehre geben, sie auf den Samstag zu einer Tasse Tee zu besuchen.«
Der Bote trat seinen Rundgang an, und die Weisen freuten sich nicht wenig über die Einladung. Nur war auch ihnen es schwer, die Namen der neun Musen zu behalten; so hörte man sie überall vor sich hin murmeln: Klio, Melpomene, Terpsichore, Thalia, Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia, Kalliope. Endlich baten sie den Simonides um einen Merkspruch, und der stellte ihnen die Anfangssilben zu folgendem reizendem Verschen zuammen:
Kliometerthal,
Euer Urpokal!
Hieraus kann man das Alter dieser Regel erkennen. Nun waren die Weisen vergnügt, und des Abends im Kegelklub schoben sie bloß noch. alle neune.
Als der Gesellschaftsabend herannahte, begann es den beiden älteren Damen Klio und Urania doch leid zu werden, daß sie so kurzweg auf ihre Herren verzichtet hatten, und sie nahmen sich im stillen vor, ihre Kolleginnen auszustechen. Klio repetierte noch einmal die Solonschen Gesetze, um sich dem Verfasser gegenüber keine Blöße zu geben, und Urania, welche es auf Thales abgesehen hatte, versicherte wiederholt, daß das Wasser der Ursprung aller Dinge und der Peripherie-Winkel im Halbkreis ein rechter sei. Infolgedessen entstand zwischen ihnen und den übrigen, welche selbstverständlich die Absicht merkten, eine leise Spannung und bei allen ein gelindes Mißbehagen, weil jede bei sich fürchtete, gerade unter den beiden zu sein, welche notwendig sitzenbleiben mußten.
Der erwartete Abend fand die Musen und Klios Salon im schönsten Schmucke, jede Muse hielt ihre frischgeputzten Embleme in der Hand und kam sich nur um wenig ungemütlicher vor als bei dem Kaffee, bei welchem sie unter sich gewesen waren. Endlich öffnete sich die Tür, und eine Anzahl ehrwürdiger Männer trat ein, welche sich als die Weisen Griechenlands vorstellten. Aber wie erstaunten die Musen, als sie nicht sieben, sondern acht Herren erblickten; denn außer den Obengenannten war auch noch Myson gekommen.
»Welcher von den Herren«, fragte Klio, »ist denn kein Weiser?«
»Dieser da!« antwortete Periander, der Tyrann von Korinth, indem er mit finsterer und stolzer Miene auf Myson wies.
»Ich bitte um Verzeihung«, entgegnete dieser, »aber ich bin ganz gewiß ein Weiser, und zwar der richtige siebente, wie geschrieben steht bei Platon im Protagoras, und dieser muß es doch wissen.«
»Er ist ein Bauer«, sagte Periander verächtlich, »der weiter nichts kann als ins Blaue starren und lachen.«
»Das ist Weisheit genug«, erwiderte Myson, »und jedenfalls besser, als andere zu Tränen zwingen. Eure Hoheit werden gestehen müssen, daß die eigene Gemahlin mit der Fußbank totwerfen oder Bäuerinnen feiertags ihren Goldschmuck wegnehmen Handlungen sind, welche einem Weisen sicherlich weniger anstehen als das Lachen.«
Periander, der sich getroffen fühlte, wollte sich unmutig entfernen, als die Tür aufs neue sich öffnete und Anarcharsis hereintrat.
»Ich habe mich etwas verspätet«, sagte dieser, »aber ich gehöre ebenfalls zu den Sieben Weisen; mein Zeuge ist Ephorus bei Diogenes Laertius, und ich sehe nicht ein, warum er unglaubwürdiger sein sollte als Platon, Pausanias, Plutarch oder irgendein anderer.«
»Gewiß, meine Herren«, rief Klio vermittelnd, »Sie sind uns alle herzlich willkommen; hatten wir doch kaum zu hoffen gewagt, daß es unter den Menschen neun Weise gegeben hat.«
»So viele wie unter den Göttinnen«, sagte Solon mit einer galanten Handbewegung.
»Verzeihen Sie«, rief da plötzlich ein neu Hinzutretender, »ich bin Epimenides, ebenfalls ein Weiser, Clemens sagt es mit Bestimmtheit; auf Dikäarchos brauchen Sie nichts zu geben. Ich stamme aus Kreta, und ich versichere Sie, daß die Kreter keine Lügner sind.«
Hinter ihm drängte sich noch ein ganzer Schwarm in die Tür, sie alle nannten ihre Namen, und jeder berief sich auf einen Autor, der ihn zu den Sieben Weisen zähle. Da waren noch Akusilaus, Leophantus, Pherekydes, Aristodemus, Pythagoras, Lasus, Anaxagoras, Pamphilus, Pisistratus, Linus, Orpheus und Epicharmus. Und als die Musen ihre Gäste zählten, da stellte es sich heraus, daß statt sieben nicht weniger als zweiundzwanzig gekommen waren, welche alle ihren Anspruch, zu den Weisen zu gehören, urkundlich beglaubigen konnten.
Die Musen faßten sich kurz und machten die liebenswürdigsten Wirtinnen. Man saß freilich ein wenig eng, aber um so lebhafter war die Unterhaltung. Der alte Bote hatte sich seine Sache leicht gemacht; er war einfach bei allen alten Griechen vorgegangen, die auf ihrem Hausschilde den Titel Sophos, das ist Weiser, führten, und so hatte er die zweiundzwanzig zusammengebracht.
Man kam auf die modernen Menschen zu sprechen, und Pythagoras meinte, sie seien sehr gebildete Leute. Ihren Pythagoras lernten sie schon in Tertia, und was man heutzutage auf Erden leiste, das ginge über alle Hypotenusen und sogar über beide Katheten. Er erzählte von der ungeheueren Macht der Europäer, von ihren Kriegsheeren und Flotten und wie sie den ganzen Erdenkreis erforscht hätten und beherrschten; er erzählte von ihren Maschinen, Eisenbahnen und Telegrafen, von ihren Fernrohren und Mikroskopen und von dem Scharfsinn, mit welchem sie alle Rätsel auf der Erde wie in den fernsten Himmelsräumen zu ergründen wüßten.
Die Musen schlugen die Hände über dem Kopfe zusammen und meinten, sie wären allerdings in den letzten Jahrzehnten nicht sehr häufig zu den Menschen hinabgestiegen, auch sei die materielle Machtentwicklung, die Industrie und Wissenschaft gar nicht ihre Sache, und in der Kunst sei ihnen der Fortschritt nicht so aufgefallen. Aber Klio und Urania müßten das eigentlich wissen.
Sie wüßten das auch, sagten diese, wenn auch nicht so genau; denn es sei jetzt sehr schwer, sich auf dem laufenden zu erhalten, und die Journale seien sehr teuer, ebenso wie die Bücher; sie könnten diese Schriften erst antiquarisch erwerben.
»Nicht wahr«, sagte eine der Musen zu Solon, »es gibt doch jetzt viel mehr Menschen als damals zu Ihren Lebzeiten?«
»Gewiß, mein Fräulein, viel, viel mehr.«
»Und wenn es schon damals unter den wenigen Menschen in Hellas zweiundzwanzig Weist gegeben hat, wieviel Weise mag es erst jetzt in ganz Europa geben? Die möchte ich einmal zusammen sehen!«
»Oder auch nur einige von ihnen kennenlernen«, rief Erato.
»Das wäre reizend«, bestätigte der Chorus. »Aber wie finden wir sie heraus, und wie bringen wir sie zusammen?«
»Zu unserer Zeit«, begann Thales, »fanden meine Landsleute einmal in einem von ihnen angekauften Fischfang einen goldenen Dreifuß, den, wie man sagt, einst Helena ins Meer geworfen hat, damit er Anlaß zum Streite späterer Geschlechter gebe. Und so kam's denn auch, daß wir mit den Bewohnern von Kos über den Besitz des Dreifußes in Streit gerieten, bis wir uns einigten, den delphischen Apoll zu fragen, wem das Kleinod gehören solle. ›Dem Weisesten! ‹ antwortete das Orakel. Da brachten die Milesier mir den Dreifuß, weil sie mich für den Weisesten hielten; sie kannten wohl Solon nicht. Ich aber schickte den Dreifuß an ihn, doch Solon, der sich nicht selbst für den Weisesten hielt, gab ihn einem andern, dieser schickte ihn wieder weiter, und so kam er denn zuletzt wieder an mich. Da weihte ich ihn dem Gotte; denn Weisheit kommt nur den Göttern zu, weshalb sich auch mein Freund Pythagoras nicht einen Weisen, sondern einen Philosophen, einen Liebhaber der Weisheit nannte. Dieser Rundgang des Dreifußes aber zeigte uns, wen wir zu unserer Zeit für weise hielten: jeden, der den Dreifuß einmal erhalten. Ich schlage nun vor, ein Kleinod mit ähnlicher Bestimmung einem der modernen Menschen zu geben und abzuwarten, an wen dasselbe kommt.«
»Das würde wenig nützen«, meinte Pythagoras, »ich kenne die jetzigen Menschen besser. Lassen wir den Dreifuß ausgraben, so werden sie die Aufschrift nicht für ernst nehmen und nicht als gültig für die Gegenwart, sondern sie werden sie historisch auffassen und als das aufgefundene Hochzeitsgeschenk des Hephästos an Pelops oder auch als eine Stiftung des Thales nach Delphi einem Museum. widmen. Wir müssen die Sache anders anfangen und selbst die Weisen aufsuchen. Wenn es den Herrschaften gefällt, so benütze ich meine altbekannte Zauberkraft, gehe unter die Menschen und bringe Ihnen in einem halben Stündchen die sicherste Auskunft zurück.«
»Und womöglich gleich einige Weise!« rief ihm Terpsichore nach, als Pythagoras schon verschwunden war.
»Ich komme mit leeren Händen«, sagte Pythagoras achselzuckend bei seiner Rückkehr. »Es gibt ja sicherlich Weise genug, aber ich habe kein Glück bei meinen Erkundigungen gehabt. Ich fragte zuerst einen Staatsminister, wen er für den Weisesten halte. Denn ich glaubte natürlich, daß diejenigen, welche die Geschicke der Völker lenken, auch am besten über den Sitz der Weisheit würden unterrichtet sein.
›Lieber Freund ‹, sagte der Würdenträger zu mir, ›Weisheit ist eine schöne Sache, wenn man sie selbst hat; aber das Wort besitzt einen verdächtigen, theoretischen Beigeschmack; es gibt sogenannte weise Leute, deren Weisheit darin besteht, daß sie alles besser wissen und am besten verstehen wollen, und eben diese kann ich Ihnen nicht empfehlen. Ich bin in praktischer Staatsmann, meine Aufgabe besteht darin, Gutes zu wirken durch Einsicht in die Verhältnisse und kluge Benützung der Menschen, und das kann ich natürlich nur, solange ich meine Macht behaupte. Darin beruht meine Weisheit, Wollte ich Ihnen sagen, wen ich für weiser hielte, so würde ich selbst aufhören, weise zu sein. Und damit Gott befohlen! Übrigens ‹, rief er mir noch nach, ›wenn Sie unter einem Weisen einen Kerl verstehen, der die Weisheit still für sich hinein mit Löffeln gegessen hat, so müssen Sie zu den Gelehrten gehen.‹
Obgleich dies nun meine Ansicht von einem Weisen nicht ist, ging ich doch zu den Gelehrten, und zwar zu einem Philosophen; denn wer sich selbst einen Liebhaber der Weisheit nennt, der muß doch die Weisen kennen, Der Mann betrachtete mich aufmerksam.
›Was verstehen Sie überhaupt unter einem Weisen?‹ fragte er mich.
›Ich verstehe darunter einen Mann‹, sagte ich, ›welcher die Welt kennt und in ihr lebt, aber nicht nach ihr strebt-, welcher die Wahrheit sucht, ohne auf Ruhm zu hoffen; welcher die Menschen liebt und Gutes wirkt, aber nach Lohn und Dank nicht fragt; welcher niemand verachtet, weil er anders sei und anders denke als er; welcher glücklich ist, weil er frei ist, milde, weil er gut, und bescheiden, weil er groß ist.‹
‹Sie sagen mir da nichts Neues, lieber Herr‹, erwiderte der Philosoph: ›diese ethischen Qualitäten, welche Sie aufzählen, erstreben wir alle in gewissem Sinne; sie kommen durchaus nicht bloß irgendwelchen hervorragenden Geistern zu. Aber eben darum besagt Ihre Definition zuviel. Sie werfen das Ideal eines Gelehrten und das Ideal eines Menschen zusammen. Das mochte zu einer Zeit statthaft sein, als die griechischen Sophoi lebten, Bildung nur wenig Bevorzugten zukam und die ganze Wissenschaft in nichts anderm bestand als in ein wenig Lebensweisheit, verquickt allenfalls mit einigen mystischen Spekulationen à la Pythagoras. Aber heutzutage haben wir Teilung der Arbeit einerseits, Gleichberechtigung der Menschen andererseits. Weise sein in Ihrem Sinne der Lebemweisheit kann ein jeder, ohne gelehrt zu sein, und es kann jemand sehr gelehrt sein, ohne eine Spur von einem Sophos zu haben. Sie scheinen mir noch sehr unklare Begriffe von der Weisheit zu besitzen.‹
›Ich bitte um Entschuldigung‹, begann ich wieder, ›aber Sie nennen sich einen Philosophen, und da ich doch diesen Namen einführte –‹
›Sie führten ihn ein?‹ Der Philosoph fixierte mich, er schien mich für etwas gestört zu halten.
›Ja‹, sagte ich, ›ich bin nämlich Pythagoras.‹
›Mein Bester‹, sagte der Philosoph, ›kommen Sie zu sich. Das ist ja eine durchaus mythische Persönlichkeit!‹
›Kurz und gut‹, fuhr ich fort, ›ich glaubte, Sie beschäftigten sich ausschließlich mit den Weisen – gibt es denn gar keine mehr? Ich hörte doch, es habe einer in Egmond gelebt und einer im Haag, einer auch in Königsberg?‹
›Die sind lange tot‹, sagte der Philosoph trocken. ›Ich muß Sie sehr bitten, die Philosophie nicht fortwährend mit einer praktischen Anwendung ethischer Grundsätze zu verwechseln. Die Philosophie ist heutzutage eine Wissenschaft, und wenn Sie mein Buch gelesen hätten, so würden Sie das wissen.‹
›Worüber schreiben denn aber meine Nachfolger, wenn nicht über die Weisheit?‹ fragte ich.
›Über andere Philosophen!‹ rief er. ›Und ich rate Ihnen dringend, sich ein wenig in der Geschichte der Wissenschaften umzusehen. Adieu, Herr – ‹
›- Pythagoras‹, sagte ich und ging.
Ich begab mich direkt hierher; denn wo sollte ich die Weisheit noch suchen? Um aber nicht ganz unverrichtetersache heimzukehren, habe ich noch ein letztes Mittel probiert, indem ich den Weg einschlug, auf welchem die Leute heutzutage berühmt werden, nämlich die Zeitungsannonce. Ich ließ meine Erklärung von der Weisheit drucken und überall ankündigen: Wer ein Weiser sein will, wie die Weisen Griechenlands, den laden die Musen zu Caste und warten sein auf dem Parnassos. Erfolg freilich wage ich mir nicht zu versprechen.«
Pythagoras hatte recht. Es kam niemand.
»Aber schätzen denn die Menschen die Weisheit gar nicht mehr?« fragten die Musen endlich.
»Sie schätzen sie hoch, sehr hoch«, versicherte Pythagoras.
»Warum wollen sie dann aber nicht weise sein?«
»Jeder will lieber, daß es ein andrer sei, nicht er selbst, der das Ehrenamt des Weisen führe.«
»Also so gutmütig und bescheiden sind die Menschen!« rief Erato erfreut. »Das hätte ich wirklich kaum geglaubt. So wollen sie nur darum nicht weise sein, damit –«
»- damit sie klüger bleiben können als die Weisen!« schloß Pythagoras.
Und die Menschen blieben es auch. Die Musen und die Weisen warteten noch viele Abende auf die Männer, welche weise sein wollen, aber sie blieben unter sich. Nur einmal glaubten sie, es käme ein Weiser; jedoch es war nur ein kleiner Junge mit großen blauen Augen, der sich verirrt hatte, weil er dem Schneewittchen seinen Pfefferkuchen bringen wollte und nach Süden gegangen war statt nach Norden. Da steckten ihm die Musen die Taschen voll Ambrosia, Solon legte ihm die Hand auf die Locken, und Melpomene und Erato küßten ihn auf den Mund und führten ihn nach Hause.
Darauf flogen sie wieder zum Parnassos, setzten sich mit den zweiundzwanzig Sophen zum Tee und sagten: »Wir können's abwarten, wir sind ja noch jung.«
Was marterst du das arme Hirn
Mit Fragen und mit Schlüssen?
Komm her und laß dir von der Stirn
Die finstern Falten küssen!
Mit Sorgen hast du nachgedacht
Dem Laufe dieser Dinge
Und zweifelst, ob der Liebe Macht
Den Weltprozeß bezwinge?
Wenn ich dir in die Augen schau',
Die lieben, klaren Augen,
Dann wissen wir ja ganz genau,
Warum wir für uns taugen.
Wir waren stets uns zugesellt,
Willst du dich recht entsinnen,
Seitdem im Raum sich dehnt die Welt
Und seit die Zeiten rinnen.
Ich glaube, daß du neben mir
Zum Zentrum dich gerichtet
Zuerst, da als Atome wir
Zur Sonne uns verdichtet.
Wir flogen dort schon Arm in Arm
Beim ersten Gravitieren,
Und wurden so gemeinsam warm
Und konnten oszillieren.
Und als der Nebelring in Glut
Geschleudert ward ins Weite,
Nicht sank uns der Atomen-Mut,
Du flogst mir zum Geleite.
Und als die Erde sich geballt,
Da hielt es uns nicht länger,
Uns band der Liebe Vollgewalt
Im Molekül noch enger.
Doch ach, entsetzlich war die Zeit,
Kaum mag ich mich erinnern;
Wir wurden grausam bald entzweit,
Mich trieb es nach dem Innern.
Dann sucht' ich, ach, von Ort zu Ort
Umsonst, die ich erkoren, –
Ich glaubte schon, es riß dich fort,
Als wir den Mond verloren.
So lebten fern wir und allein
Millionen wohl von Jahren;
Mein Herz, mein Herz war ewig dein –
Erst spät hast du's erfahren.
Als das Geschick von dir und mir
Sich endlich ließ erbitten:
In der Grauwacke krebsten wir
Als kleine Trilobiten.
Als in der Kohlenformation
Wir dann uns wiederfanden,
Warst du ein Labyrinthodon,
Ich lag in deinen Banden.
Auf deinen holden Wickelzahn
Sang ich ein Lied alsbalde,
Sah ich dich mir von ferne nah'n
Im Sigillarienwalde.
Im Trias und im Jura auch
Und im System der Kreide
Warst du nach treuer Liebe Brauch
Mir Trost und Augenweide.
Wir wurden endlich miozän
Und Säugetier-gestaltet;
Und selber in der Eiszeit Weh'n
Sind wir uns nicht erkaltet.
Und immer klüger wurden wir,
Als Jahr' auf Jahre gingen;
Ich bin gewiß, nur neben dir
Zum Menschen könnt' ich's bringen.
Denkst du daran, wie um und um
Vor uns die Tiere zagten,
Als wir noch im Diluvium
Den Höhlenbären jagten?
Mit meiner Axt von Feuerstein
Hab' ich in jenen Tagen
Rhinozerosse kurz und klein
Zur Freude dir geschlagen.
In unsrer Höhle saßen wir
Aus Knochen Mark zu saugen,
Und schon wie heute sah ich dir
In die geliebten Augen.
Und wo wir auch im Lauf der Zeit
Noch später uns getroffen,
Du warst allein in Luft und Leid
Mein Sehnen und mein Hoffen,
Ob wir am heil'gen Nilusstrand
Zum Isissterne blickten,
Und ob wir im gelobten Land
Vom Stock die Traube pflückten;
In Aphroditens heil'gem Hain
In stillen Mondesnächten,
Wie in des Zirkus dichten Reih'n
Beim grimmen Todesfechten;
Nach blutiger Barbarenschlacht
Im Flammenschein der Städte,
in deutsche Kirchen düstrer Nacht
Bei Weihrauch und Gebete.
Und heute wieder ganz modern
Lieb' ich dich ohne Maßen.
Ich grüße höflich dich von fern,
Treff ich dich auf den Straßen.
Dein Bild, gemalt vom Sonnenstrahl,
In meiner Tasche trag' ich,
In Versen meine Liebesqual
Dir durch die Reichspost sag' ich.
Es zischt der Dampf, es saust das Rad,
Es regt sich ohne Endnis.
Es ringt die Welt mit Wort und Tat
Nach freier Selbsterkenntnis.
Und wenn zu neuem Leben wir
Hier wiederum erwachen,
Dann fahr' ich durch die Luft mit dir,
Sturmgleich, im Flügelnachen!
Es hatte eben dreizehn geschlagen, und im mittleren Deutschland fing es an zu dunkeln, wenn auch die staatliche Zentralbeleuchtung und die neu eingeführte Weltzeit, die sich nach dem Meridian von Washington richtete, über die Tatsächlichkeit eingetretener Dämmerung hinwegzutäuschen suchte. An dem Untergange der Sonne ließ sich nichts ändern, weder durch neue Gesetze noch durch internationale Verträge, und das war freilich sehr bedauerlich, wenn man bedenkt, wieviel Zeit durch die schlechte Angewohnheit der Sonne, die Hälfte des Jahres unter dem Horizont zu sein, für die produktive Arbeit verlorengeht. Da die Menschen wieder einmal unzufrieden waren, so suchten sie nach einem Prügelknaben für ihre eigene Jämmerlichkeit, und es entstand die Partei der Antisomnisten oder Schlaffeinde, welche den allnächtlichen Schlummer als die kulturuntergrabende Gewalt anklagten und befehdeten. Aber das war nur ein schnell bereuter Narrenstreich des höheren Pöbels, dessen hohläugige Gesichter bald anzeigten, was sie ohne den »Schmarotzer« Schlaf waren. Indes blieb es nicht zu leugnen, daß die Gewohnheit des Schlafes zugenommen hatte: Man schlief mehr als früher. Sobald dies statistisch festgestellt worden, erschien der Kopernikus des Schlafproblems, welcher die große Frage durch die Umkehr löste und dem alternden Europa einen neuen Völkerfrühling verhieß, wenn es sich dem intensiven Massenschlafe zu huldigen entschlösse.
Die Biomystik, eine neue Stufe der veralteten Biologie, hatte die Entdeckung gemacht, daß die Tendenz der menschlichen Entwicklung nach der Seite des Schlaf- und Traumlebens gerichtet sei. Daß der Mensch mit der rauhen Wirklichkeit zurechtkommen könne, hatte sich als eine Täuschung der Realisten erwiesen; je mehr die Kultur fortschritt, um so ohnmächtiger stand sie den Forderungen des Tages gegenüber, um so weniger vermochte sie den neuen sozialen Problemen gerecht zu werden. Aber die Natur reguliert sich bekanntlich selbst. Was die Kultur nicht leisten konnte, schien der Organismus übernehmen zu wollen. Der moderne Mensch schlief, er schlief viel mehr als der Mensch des neunzehnten Jahrhunderts, welcher doch zweifellos schon verschlafener war als der antike Mensch. Mehr schlafen, mehr träumen! Das war die einfache biologische Lösung des großen Kulturrätsels, auf welche die Philosophen des neunzehnten Jahrhunderts nicht gekommen waren. Und die Sache lag doch so einfach.
Der moderne Kulturfortschritt charakterisiert sich durch die immer mehr hervortretende Übertragung der Arbeit von dem Körper auf den Geist. Muskelanstrengung wird durch Gehirnleistung ersetzt. Die natürliche Folge ist die überwiegende organische Ausbildung des nervösen Apparats. Hatte sich die Überreizung des Denkorgans schon früher in der gesteigerten Nervosität einzelner hervorragender Individuen geltend gemacht, so ergriff dieselbe jetzt die ganze Gattung. Die organische Fortbildung erforderte daher die längere Schlafruhe. Solange man aber schlummert, spart man Essen und Trinken. Folglich reduzierte sich der Nahrungsbedarf der Kulturmenschheit in demselben Verhältnis, in welchem ihre Schlafsucht durch Gehirnüberreizung zunahm. Das war der geniale Kunstgriff der Natur, durch welchen sie die Ernährungsfrage, den schwierigsten Teil des sozialen Problems, glücklich löste. Die Menschheit entwickelte sich in dem Sinne, daß die Nahrungsaufnahme durch den Schlaf ersetzt wurde. Dies geschah ungeachtet des Widerspruchs der Physiologen, welche behaupteten, daß eine verminderte Ausgabe noch keine Einnahme bedeute. Sie verkannten jedoch die Natur der Gehirnarbeit. Ein Metaphysiker bewies dagegen mit Leichtigkeit, das Endziel der Erdentwicklung bestehe darin, daß die Menschheit. nach und nach der Periode ewigen Schlafes sich nähere; ist diese erreicht, so hören Geburt und Tod auf, die Gattung wird konstant, und die individuelle Unsterblichkeit ist gesichert; zugleich aber herrscht allgemeine Glückseligkeit, indem das sorgenfreie und verantwortungslose Traumleben an Stelle der harten und strengen Wirklichkeit tritt. In diesem Sinne seien die theologischen Vorstellungen vom Jenseits zu verstehen. Der Philosoph begründete seine Ansicht hauptsächlich damit, daß die beglückende Wirkung seines hervorragendsten Werkes schon jetzt in der schlafbringenden Eigenschaft desselben sich zeige.
Schlaf war das nationale Ideal geworden. Alle staatserhaltenden Parteien waren einig, daß das Wohl des Vaterlandes geknüpft sei an die möglichst große Schlafmenge der Individuen. Man verglich die Länder nicht mehr nach ihrer Kornproduktion, ihrem Kohlenreichtum, ihrer Industrie, ihrem Export, ihrem Kindersegen, ihrer Wehrkraft, ihrer Steuermenge, berechnet für den Kopf der Bevölkerung, sondern lediglich nach der Zahl der verschlafenen und verträumten Stunden. Es zeigte sich zur Beruhigung aller Patrioten, daß Deutschland an der Spitze der Zivilisation – schlummerte, und man sah jetzt ein, daß der politische Traumzustand, den man den Deutschen ehemals zum Vorwurf gemacht hatte, nichts weiter gewesen war als eine noch unverstandene Vorgeschrittenheit in der europäischen Kulturentwicklung. Es gab nur noch einen kleinen und von jeher verachteten Rest von Antisomnisten, die den Schlaf für ein Übel hielten; die übrigen Parteien entzweiten sich bloß in der Frage, durch welche Mittel der Schlaf am besten befördert werde, und befehdeten sich hierbei allerdings mit maßloser Heftigkeit. Die » Wohlmeinenden«, wie sich die eine Partei genannt hatte, waren der Ansicht, daß die Schlafsucht des Volkes duch künstliche narkotische Mittel möglichst zu steigern sei. Der Staat habe die Pflege des Volksideals mit Gewalt in die Hand zu nehmen, den Anbau und die Herstellung schlaffördernder Produkte durch Zuschüsse zu heben, den Kaffee gänzlich zu verbieten, Schlafprämien einzuführen. Die Gegenpartei, welche sich selbst die » Gutmeinenden« nannte, erstrebte dagegen die Schlafvermehrung auf dem Wege geistigen Einflusses. Sie verbreitete zu diesem Zwecke die Parlamentsreden beider Parteien und der Regierungskommissarien, unterstützte junge lyrische Dichter in der Drucklegung und namentlich der Vorlesung ihrer Poesien – wobei die Auditorien mit bequemen Schlafsofas ausgestattet waren –, gab die großen Philosphen des neunzehnten Jahrhunderts in billigen Volksausgaben heraus und ließ damals berühmte Opern pianissimo aufführen.
Der Abgeordnete Siebler, ein enthusiasmierter »Wohlmeinender«, hatte eben im Volksverein »Langeweile« eine glänzende Rede für das Schlaf- und Traummonopol des Staates gehalten, in welcher er ausführte, daß die Schlaf- und Traum-Verteilung für den einzelnen künftighin staatlich zu regeln und zu überwachen sei. Eine Rede galt für um so gelungener, je rascher die Zuhörer einschliefen; der glückliche Redner hatte dann zugleich den Vorteil, daß ihm niemand entgegnete. Siebler sprach so erfolgreich, daß er selbst das Ende seiner eigenen Rede verschlief; etwas Ähnliches war früher nur einigen Schriftstellern beim Niederschreiben ihrer eigenen Feuilletons gelungen. Freilich war die äußere Einrichtung der Volksversammlungen ihrem Zwecke entsprechend. Da gab es kein gemeinsames Lokal der Zusammenkunft, sondern jedes Mitglied war mit dem Rednersofa telefonisch verbunden und hörte bequem von seinem eigenen Ruhebett aus die Reden beziehungsweise meldete sich dazu. Der beliebten Klage der Hausfrau wegen zu späten Nachhausekommens war damit ein für allemal der Boden entzogen; andererseits kam es allerdings vor, daß ein Redner mitten im Satze abbrach, weil ihm die Gattin das Telefon vom Munde nahm; aber man vermutete dann, er sei bei seinen eigenen Worten eingeschlafen, und ehrte ihn als patriotischen Mann, der das Nationalheiligtum hochhielt.
Siebler war Witwer und hätte daher ruhig ausreden können, wenn sein Reden nicht so schlummerungsbegeisternd auf ihn selbst gewirkt hätte. Aber während alle seine Zuhörer bei seinen Worten in einen wahrhaften Gähnjubel ausbrachen, lauschte im Nebenzimmer bangen Herzens seine Tochter Amalie den politischen Ausführungen ihres eigensinnigen Vaters. In ihre großen braunen Augen kam kein Schlummer; unaufhörlich zerbrach sie sich das blonde Köpfchen, wie sie die eben gehörten schroffen Ansichten mit ihren seit Monaten gehegten Lieblingsplänen vereinigen könnte. Wie sollte das werden? Schon immer standen der Vater und ihr heimlich geliebter Dormio Forbach sich als »Wohlmeinender« und »Gutmeinender« politisch verfeindet gegenüber, und das war der Grund gewesen, warum Dormio noch nicht gewagt hatte, um Amalie anzuhalten. Nun aber trat der Vater auch noch gegen die privaten Interessen ihres Dormio auf, wenn er die Verstaatlichung der Schlaf- und Traumanstalten betrieb. Denn Dormio war Traumfabrikant.
Kaum hatte sich Amalie jetzt von der Festigkeit des väterlichen Schlafes überzeugt, als sie den Sprechanschluß an die Forbachsche Traumanstalt bewirkte. Zärtliche Worte und elektrisch treu vermittelte Küsse feierten den ungestörten Verkehr der Liebenden, bis ihre Sorgen sich in Klagen Luft machten. Endlich erklärte Forbach entschieden, er würde morgen den Versuch wagen, mit Amaliens Vater zu sprechen, möge der Erfolg sein, wie er wolle. Wenn es nur ein Mittel gäbe, den Vater in eine günstige Stimmung zu versetzen! Vielleicht durch einen Traum? Daran hatte Amalie natürlich schon öfter gedacht; aber wie sollte sie den Vater bewegen, sich Forbachs Behandlung zu unterziehen, da er ein entschiedener Gegner der privaten Traumfabrikation war? Eben wollte sie über diese Frage mit dem Geliebten weitere Rücksprache nehmen, als derselbe sich durch Geschäfte gezwungen sah, die Unterredung auf einige Zeit zu unterbrechen. Einer seiner Kunden hatte sich darüber beschwert, daß er immer von seiner Schwiegermutter träume; dem solle man abhelfen.
Der Schlaf hatte die materielle Seite des sozialen Problems gelöst, der Traum sollte die Gemütsfragen in Ordnung bringen. Während des Schlafes denkt der Mensch nicht, das heißt, er denkt nicht in der Art, wie es im Wachen geschieht oder geschehen soll, unter strengster Observanz der Sätze von der Identität, vom Widerspruch und vom zureichenden Grunde. Im Schlafe wird nur geträumt, nicht geprüft und gefolgert. Es kommt uns im Traume gar nicht darauf an, uns plötzlich in abgerissenem Anzuge die Straße fegen zu sehen, dabei aber auf den Schultern unseres vorgesetzen Kabinettschefs spazierenzureiten; wir versetzten ihm mit unseren Füßen einige Rippenstöße, worauf er eine Tabakspfeife aus der Tasche zieht, in welcher wir unsere treulose Geliebte erkennen; während wir dieselbe in den Armen halten, bemerken wir, daß es unsere in Amerika verstorbene Erbtante ist, die sich in einen unendlichen Regen heller Sterne auflöst, von denen wir nicht zu erkennen vermögen, ob es funkelnde Küsse oder heimliche Goldstücke sind – wer kennt nicht diese wirren Phantasiespiele, über welche wir uns nicht im geringsten wundern? Glückliches Volk, das anstatt der unerbittlichen Konsequenz politischer Kritik oder wissenschaftlicher Forschung frei vom Satze des Widerspruchs sein heiteres Traumdasein genießt! Da staunt man nicht mehr über die entgegengesetzte Deutung gleicher Tatsachen aus demselben Munde, nicht über den Gesinnungswechsel eines Mannes, nicht über die positive Erklärung, daß schwarz weiß sei; still vergnügt nimmt man alles hin und tut doch, was man will. Denn die Menschen tragen keine Verantwortung. Sie träumen, und was sie träumen, verschwimmt mit dem Erwachen, nur die süße Erinnerung der Freiheit bleibt. Am Tage einige wache Stunden engumschriebenen Wirkens im streng geregelten Mechanismus des bürgerlichen Lebens, dann sinken sie beseligt wieder in die sanften Arme des Schlafgottes, um den lieblichen Reigen der Traumelfen zu teilen. So löst sich das zweite große Problem der Kultur, wie die individuelle Freiheit zu vereinen sei mit dem notwendigen Zwange staatlicher Ordnung. Je weniger die Menschen wachen, um so weniger bedürfen sie des Zwanges, um so weiter dehnt sich das Reich seliger Traumfreiheit.
Aber diese Freiheit darf keine Bestimmungslosigkeit sein. Sie soll erquicken, nicht durch Überraschungen quälen. Daher muß nach Mitteln gesucht werden, wenigstens die allgemeinen Bahnen des Traumverlaufs zu bestimmen, die Schreckbilder abzuhalten, die ungefähre Richtung der dichtenden Phantasie vorzuschreiben. Auch dies Problem hatte die Biomystik gelöst; ein Professor der Physiologie, der sich in somnambulen Zustand versetzt hatte, entdeckte im Hochschlafe das » Traumorgan «.
Ja, das Traumorgan existierte wirklich, und zwar dort, wo es die Verehrer des tierischen Magnetismus gesucht hatten, in der Nähe der Magengrube, mit welcher die Somnambulen bekanntlich lesen können; es saß im sogenannten Sonnengeflecht des Gangliensystems in Gestalt eines die Nervenbläs- chen erfüllenden spezifischen Nervengases und hatte die empirische Formel
C 632 H 418 N 26 S 8 F e2 O 99.
Man hatte es einem Mörder exstirpiert, der vor Gewissensbissen nicht schlafen konnte; seitdem erfreute er sich eines ruhigen, traumlosen Schlafes. Ein Philosoph, welcher dem Mystizismus huldigte, verlor das Traumorgan durch einen unglücklichen Sturz auf den Magen, indem er über eine seiner nachschleppenden Perioden stolperte; seit jenem Tage schrieb er durchaus klare Bücher.
Dormio Forbach war Spezialist für das Traumorgan. Er wirkte darauf teils direkt durch äußere Reize, teils setzte er die einzelnen Teile der Hirnrinde mit dem Traumorgan nach Bedürfnis in Verbindung und lenkte dadurch den Gang der Traumphantasie. Seine Haupteinnahme bildete der Verstand des von ihm fabrizierten Traumgases, das in besonders präparierte Kautschukkissen gefüllt und von den Abnehmern eingeatmet wurde. Diese Traumkissen waren außerdem mit Vorrichtungen versehen, wodurch leichte Reize auf diejenigen Organe des Schlafenden ausgeübt wurden, deren Tätigkeit im Traumbilde in Anspruch genommen werden sollte. Ein Augenreiz zauberte Farbenspiele hervor, welche die Traumphantasie nach Maßgabe der gleichzeitigen übrigen Reize und der stattfindenden Vorstellungsassoziationen zu beliebigen Bildern umschuf. Wollte man zum Beispiel Landschaften sehen, so wurde zugleich in passender Weise auf das Ohr gewirkt, man sprach die Namen von bekannten Bergen und Gegenden aus, ließ das Geräusch rasselnder Wagen oder sanften Herdengeläutes ertönen und lenkte dadurch die Assoziation der Traumbilder.
Dem unzufriedenen Besteller, der sich über den Traum von der Schwiegermutter beschwert hatte, ließ Forbach ein anderes Traumkissen zurechtmachen.
»Man kann gar nicht genug auf die Individualität der Kunden achten«, sagte Forbach zu seinem Assistenten. »Hätte ich gewußt, daß der Mann verheiratet ist, so hätte ich mich vorgesehen. Sie wissen, wie es uns neulich mit der Bestellung auf Träume von Landschaftsbildern ergangen ist. Der Schläfer hielt den Lichtreiz für ein Schadenfeuer statt für den Sonnenaufgang, aus dem Kuhreigen machte er Feuerlärm, sprang aus dem Bette und goß das Waschbecken darüber. Wir mußten den Schaden bezahlen.«
»Der Mann hatte vermutlich zuviel Traumgas eingenommen.«
»Das nicht, aber er war Brandmeister.«
Forbach brach einen Brief auf, warf ihn aber sogleich ärgerlich auf den Tisch.
»Da haben wir denselben Fall!« rief er. »Doktor Mieriger meldet sich ab; was uns denn einfiele, ihn vom Ausbruch der Cholera träumen zu lassen! Was in aller Welt haben Sie ihm denn geschickt?«
»Er wünschte angenehme geschäftliche Träume, und so sandte ich ihm Kissen Nummer sechs mit leichten Karbolreizen und Trauermarsch. Ich glaubte, für einen Arzt müsse es sehr angenehm sein, von einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Stadt –«
»Ja, ich bitte Sie, Doktor Mieriger ist nicht Mediziner –«
»Nicht möglich! Was denn?«
»Direktor einer Lebensversicherungsbank.«
»Dann freilich! So will ich mich sogleich entschuldigen.«
Es klopfte, und ein höchst eleganter, etwas stutzerhaft gekleideter Herr trat ein.
»Ich wollte mir die Frage erlauben«, sagte er, »ob Signora Muratori an die Traumleitung angeschlossen ist.«
»Gewiß, Nummer einhundertsiebzehn.«
»Dann bitte, heute nacht unausgesetzt meinen Namen einzuflüstern: Alboin von Warzheim.«
»Können Sie sich über den persönlichen Auftrag des Fräuleins ausweisen?«
»Das nicht, ich handle in meinem eigenen Auftrage.«
»Dann bedauern wir, Ihren Wunsch nicht erfüllen zu können. Wir dürfen nach dem Traumgesetz nur Anträge von den betreffenden Personen selbst ausführen.«
»Aber bitte, machen Sie hier eine Ausnahme. Bin sterblich verliebt – aussichtslos! Ich habe einen ähnlichen Fall gelesen, in welchem die Mutter dem unglücklichen Liebhaber Namenseinflüsterung gestattet, worauf Traum, Beschäftigung mit seiner Person, Neigung, Verlobung. Wollen Sie gefälligst beliebigen Preis bestimmen, kommt mir nicht darauf an.«
»Mein Herr«, sagte Forbach, »ich kann nicht weiter mit Ihnen verhandeln. Die geringste Pflichtverletzung würde mich für mein verantwortliches Amt unbrauchbar machen. Niemals werde ich von den gesetzlichen Vorschriften abweichen.«
Kaum hatte sich Herr von Warzheim unwillig entfernt, als Forbach sich wieder zur Unterhaltung mit seiner geliebten Amalie anschickte. Diese hatte sich inzwischen ausgedacht, Forbach sollte für ihren Vater ein besonders präpariertes Traumkissen senden, das sie ihm heimlich unter den Kopf legen würde. Seinen Lieblingsneigungen wollte sie damit entgegenkommen; eine Jagd, ein gutes Diner, eine lustige Unterhaltung konnten leicht durch passende Reize ins Traumbewußtsein gehoben werden; war dadurch die gute Laune des Vaters gesichert, so wollte sie ihm ihre Verbindung mit Dormio Forbach durch Einflüsterung als einen trefflichen Gedanken erscheinen lassen. Auf diese Weise hoffte Amalie, die morgen bevorstehende Werbung am besten vorzubereiten.
Aber wie war sie enttäuscht, als Forbach diesen Plan rundweg verwarf. Er dürfe nun einmal ohne Einwilligung des Träumenden keinen Einfluß ausüben, selbst nicht, wenn sie, die Tochter, die Verantwortung übernehme. Vergebens bat und schmeichelte Amalie; so hart es ihn ankam, Dormio blieb fest; er erzählte ihr, wie er eben genötigt gewesen sei, Herrn von Warzheim abzuweisen, und berichtete von ähnlichen Anfechtungen, die ihm häufig genug begegneten. Dann betonte er die Gefahr, die in der zufälligen Entdeckung des Traumkissens durch Siebler läge. Welche Handhabe wäre ein solcher Vorfall gegen die Zuverlässigkeit der privaten Traumanstalten! Endlich aber, da Amaliens Starrköpfchen dies alles nicht gelten lassen wollte, machte er sie darauf aufmerksam, daß der Erfolg selbst ganz unsicher sei. Man könne nicht wissen, ob nicht gerade die Erwähnung seines – Forbachs – Namens zusammen mit dem Amaliens die heiter stimmende Traumwirkung wieder aufhebe und einen Unlusttraum erzeuge, der nun als Warnung für das wache Handeln wirken und somit ihren Plänen gerade entgegenarbeiten würde.
Amalie schmollte. Wenn Dormio so eigensinnig sein wollte, so möge er nun auch zusehen, wie er morgen mit dem Papa fertig werde; und so sagte sie ihm in etwas gepreßter Stimmung »Gute Nacht«.
Der vergötterte Schlaf, von allen als Friedensbringer gepriesen und darum zum Objekt hartnäckigsten Streites gemacht, der gehorsame Begleiter der väterlichen Reden, wollte der Tochter nicht nahen, die ihr Haupt in stetem Nachsinnen auf dem heimlich ihr von Forbach geschenkten Traumkissen umherwarf. Dormio verdiente es zwar nicht, daß sie sich um ihn kümmerte, aber wenn er morgen beim Vater kein Gehör fand, mußte nicht sie am meisten darunter leiden? Konnte sie denn gar nichts tun? Als Kind ihrer Zeit und Weib aller Zeiten kam sie von dem einmal gefaßten Gedanken an die Wirksamkeit des Traumes nicht hinweg. Aber das einzige, was sie zur Verfügung hatte, war ihr eigenes Traumkissen, mit Traumgas gefüllt und mit jenen ewigen Melodien ausgerüstet, welche Liebessehnsucht von jeher und überall in den Menschenherzen geweckt hat:
»Freudvoll und leidvoll,
Gedankenvoll sein,
Langen und bangen
In schwebender Pein,
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrübt,
Glücklich allein ist die Seele, die liebt!«
Wie wonnig träumte es sich auf diesem Kissen, in diesem beseligenden Wechsel der Stimmungen, der sich auf dem Grundgefühle frohen, sicheren Besitzes eines unendlichen Glückes abspielt. Die Willensregungen und Affekte egoistischen Ursprungs verschmelzen mit den Gefühlen, die in der Sympathie wurzeln – das ist die Liebe. Stolz und Selbstbewußtsein erfreuen und lösen sich doch willig in der unbedingten Hingabe, Genuß und Entbehrung beglücken gemeinsam, und der Schmerz ist Wonne. – Wie müßte das Kissen auf den Vater wirken! Sollte es nicht die Erinnerung glücklicher Jugend hervorzaubern, Milde in das Herz gießen und dem Verständnis zarter Regung geneigt machen? Sollte es nicht wenigstens eine besänftigende und erheiternde Wirkung ausüben? Es konnten doch nur gute Träume dadurch erzeugt werden, und auf gute Träume folgt ein friedliches Erwachen.
Amalie schlich sich leise in das Zimmer des Vaters und schob vorsichtig dem fest Schlummernden das Kissen unter das Haupt. –
Ächzend und stöhnend ermunterte sich am andern Morgen der Abgeordnete Siebler aus einem schweren Traum; erst als er sich überzeugt hatte, daß er nur geträumt, erheiterten sich wieder seine Züge, und er atmete erleichtert auf. Mit Spannung und Besorgnis beobachtete Amalie ihren Vater beim Frühstück, um die Wirkung des Traumkissens zu erkennen.
Er war sehr einsilbig und offenbar mit einer wichtigen Überlegung beschäftigt. Die Zeitungen, denen er sonst einige Morgenstunden zu widmen pflegte, sah er kaum an, sondern ging unruhig im Zimmer auf und ab. Zufällig haftete sein Blick unter den Anzeigen auf einer Geschäftsempfehlung Forbachs; das paßte in seinen Gedankenkreis, und er erinnerte sich mancher halbunterdrückten Seufzer und versteckten Andeutungen seiner Tochter. Er rief Amalie und sagte zu ihrer größten Überraschung: »Du kennst ja diesen Traumfabrikanten Forbach. Weißt du, daß ich Lust hätte, mich einmal an ihn zu wenden. Wenn mir nur jemand für seine Zuverlässigkeit garantieren könnte!«
Natürlich wußte Amalie mehr als eine Familie aus ihrem Bekantenkreis zu nennen, die auf Forbach zu schwören bereit war, und die ausgezeichneten Traumwirkungen seiner Offizin belegte sie mit zahlreichen Beispielen. Als sie den Vater so unvermutet zugänglich fand, ging sie nun auch gleich mutig vor und wußte ihre Sache so schlau zu führen, daß sie der Einwilligung des Vaters, der ja außer seinem bisherigen Mißtrauen bezüglich des Traumgeschäfts gegen Forbach gar nichts einzuwenden hatte, bereits sicher war, als letzterer sich melden ließ. Da wurde es denn Forbach nicht schwer, seine Sache zu führen.
»Gegen die Reellität und den Wert Ihres Geschäfts«, sagte Siebler, »kann ich nach den vorgelegten Ausweisen nichts einwenden; und um mich vollständig von Ihren Leistungen zu überzeugen, melde ich mich und meine Tochter als Abonnenten auf Ihr Traumgas bei Ihnen an.«
Und als er die Hände des glückstrahlenden Paares ineinandergelegt hatte und alle drei vor der alten, abgelagerten Flasche köstlichen Neunzehnhundertundneunundneunzigers saßen, da sagte Siebler: »Damit ihr euch nun nicht länger wundert, Kinder, wie ich dazu komme, meine gestrige Rede für das Traummonopol heute so weit zu verleugnen, daß ich mich diesem Privatfabrikanten hier ausliefere, so will ich euch sagen, daß ich beschlossen habe, mich überhaupt von der Politik zurückzuziehen und kein Mandat mehr anzunehmen, wenigstens so lange nicht, als die Traumfrage auf der Tagesordnung steht. Ihr seht mich höchst verwundert an und fragt, wie ich dazu komme, und ich sage euch zur Antwort: durch einen niederträchtigen Traum, den ich diese Nacht hatte. Nun, lieber Dormio, Sie werden dafür sorgen, daß mir ähnliches nicht passiert; eben zu diesem Zwecke bin ich Ihr Kunde geworden.«
»Was war das für ein schrecklicher Traum?« fragte Forbach eifrig, während Amalie schuldbewußt tief errötete.
»Zuerst«, fuhr Siebler fort, »hatte ich ein äußerst angenehmes Gefühl, das ich kaum beschreiben kann; es war das Gefühl erreichter Sehnsucht, das zwar mit dem Bedürfnis neuen Ringens und Kämpfens wechselte, aber doch immer die freudige Sicherheit des Sieges beibehielt; ein Aufundniederschwanken der Stimmung mit dem Vorwiegen der Befriedigung; immer glaubte ich die Worte des Dichters zu hören
»Freudvoll und leidvoll,
Gedankenvoll sein,
Langen und bangen
In schwebender Pein,
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrübt –«,
aber die Schlußzeilen fielen mir nicht ein.«
Forbach sah Amalie fragend an und sagte zu Siebler: »Und wie malte Ihnen der Traum diese Stimmung? Denn der Traum spricht nur in Bildern.«
»Ganz richtig, nur konnte ich sie nicht festhalten und muß mich begnügen, Ihnen den Gesamteindruck zu schildern. Das wesentliche Moment aber war dieses: Es wurde über das Traummonopol abgestimmt, und schließlich hatte ich die entscheidende Stimme abzugeben. Ich stimmte dafür, es ging durch, und sofort auch war ich Traumminister. Ja, ich war verantwortlicher Chef des gesamten kolossalen Apparats der Schlaf- und Traumverteilung. Ich steckte bis an den Kopf in Seifenblasen, die ich fortwährend nach allen Seiten hin verteilen mußte, indem ich unausgesetzt in den Haufen hineinblies; da flogen sie nach jeder Richtung, und immer neue quollen hervor. In einem ungeheuren Amphitheater aber saß das gesamte Volk, jedem einzelnen flog eine Seifenblase an den Kopf und zerplatzte; sie wurde zu Glasscherben, die man mir mit Grimassen zurückwarf, und bald steckte ich bis an die Brust in den scharfen Splittern. »Das ist nicht mein Traum«, schrie der eine; »ich will einen andern«, der zweite; »heute will ich gar keinen« der dritte; »das ist ja erbärmliches Zeug«, der vierte; und so ging es weiter mit Beschwerden, und jedesmal flogen mir die Scherben um den Kopf. Jetzt sah ich, daß es gar nicht die Leute waren, welche riefen, sondern ringsum saßen große, gedruckte Zeitungslettern, und ein riesiges Ausrufezeichen schrie mich an: »Sehen Sie, Exzellenz Siebler, jetzt nehmen wir den Traumetat vor, und jetzt sollen Sie einmal die ganze Geschichte, die Sie uns haben träumen lassen, wieder zurückträumen, aber von hinten nach vorn.« Dabei wuchs der Scherbenberg um mich immer höher, ich jedoch wuchs selbst mit ihm und trat die Trümmer unter die Füße. Das schmerzte mich, aber das Herz schwoll mir voll Stolz, mir war es, als seien all die tobenden Gestalten Stücke von mir und als müßte ich mich ihnen hingeben, um sie zu erquicken und zu sättigen mit meinem Lebensatem. Und ich blies und blies mit aller Kraft neue und neue Traumblasen in die Menge. Mächtiger und mächtiger quollen sie hervor und bedeckten die ganze Versammlung. Der Atem begann mir auszugehen, die Brust wollte mir springen, so gewaltig blies ich; und ich glaubte sicher, jetzt müßten alle mir danken; denn ich hatte das Volk ganz umhüllt mit rosigen Träumen. Wieder aber flogen die Splitter zu Boden, die Tribünen wuchsen höher und höher, und hernieder toste es- »Wir wollen deine uniformierte Weltstimmüng nicht! Nieder mit dem Normaltraum!« Ich aber rief dagegen: »Nehmt, was ich habe, mehr kann ich nicht geben!« So blies ich mit meiner letzten Kraft Wolken von Seifenblasen hervor, und ich hatte ein Gefühl, als zerstöbe ich in Millionen Teile. Die Leute ringsumher haschten danach, hielten sie vor die Augen und warfen sie wütend fort.
»Auf jeder Traumblase ist sein Bild!« schrien sie. »Nun sollen wir ihn selber träümen!« Da flog mir ein Splitter ins Auge, das war, als ginge ein neues Licht rings um mich auf, und ich sah zu meinem Entsetzen, daß all die Seifenblasen im ganzen Raum mein eigenes Bildnis trugen, überall sah ich nur mich selbst; ich blies nicht mehr, aber immer aufs neue quollen die Blasen mit meinem Ebenbild hervor, sie häuften sich um mich und drohten mich zu ersticken; nur dumpf noch grollten in der Ferne die zornigen Stimmen, und vergebens griff ich mit den Armen umher, um mich an einen Menschen zu klammern außer mir. – So wachte ich auf, in Angstschweiß gebadet. Und da schwor' ich mir, ferner nicht mehr – nun, kurz und gut, die Traumpolitik ist mir verleidet.«
Erregt durch die Erinnerung, schritt er im Zimmer auf und ab.
»Du hattest«, sagte Forbach leise zu seiner Braut, »dein Traumkissen –«
Amalie nickte. »Verrate mich nicht«, bat sie.
»Nein«, sagte Dormio; »aber du siehst die Folgen der künstlichen Traumbeglückung. Wir können nur allgemeine Züge vorzeichnen, über den Erfolg entscheidet stets die Individualität. Denn das Traumbild ersteht aus dem Vorrat der im Bewußtsein angesammelten Vorstellungen nach Maßgabe der gewohnten Assoziationen. Dadurch sondert sich das Ich vom Ich, und die unendliche Mannigfaltigkeit dieser Wirklichkeit vermag keine Traumvorsehung, kein klügelndes und wohlgemeintes Denken zu überblicken, geschweige denn zu regeln. Dein Traumkissen lieferte Selbstgefühl und Aufopferung; aber was bei dem Liebenden sich in freundliche Harmonien löst, bei dem Parteimann geht es in beängstigenden Kampf über. Das Glück der Liebenden wächst mit der Hingäbe der Persönlichkeit, das Glück der Völker fordert die freie Entwicklung der Einzelart.«
»Aber«, unterbrach ihn Amalie fragend, »dann steht es doch mit deiner Traumfabrikation eigentlich recht bedenklich.«
»Nicht schlechter und nicht besser als mit allen anderen menschlichen Vorausberechnungen. Das Leben ist zu bunt, glücklich allein ist die Seele –«
»Stoßen wir an«, sagte Siebler, wieder an den Tisch tretend, »auf den glorreichen Sieg des Menschengeistes über das Schicksal, auf die Herrschaft des Kunsttraumes, des sicheren Führers des Kulturfortschritts!«
Die Gläser klangen, die Liebenden drückten sich die Hände. In ihren Augen lasen sie etwas, was sicherer war als Schlaf und Traum; aber sie sagten es natürlich nicht. Einem Kulturideal widerspricht man niemals.
Es war einmal ein Privatdozent der Philosophie, der hieß, um allen Verwechslungen vorzubeugen, Dr. Schulze. Eines Nachmittags saß er an seinem Schreibtische und konnte seine Gedanken nicht ins reine bringen; das hätte zwar weiter nichts geschadet, wenn er sie nur im Konzept gehabt hätte, aber das war ihm gerade ausgegangen. Da hatte nun ein Autor Schulzen wieder einmal gründlich mißverstanden! Das kommt von diesem Widerspruchsgeist, der sich überall breitmacht, von dieser prinzipiellen Unzufriedenheit, die nichts anderes gelten lassen will als die eigene Meinung! Wollten doch die Leute endlich einsehen, daß Überzeugung den größten Sieg feiert, wenn sie sich der besseren aufopfert! Aber wer kann die Gelehrten überzeugen? Sollte es nicht ein Mittel geben, den störenden Widerspruch unwirksam zu machen? Die Wahrheit redet ja für sich selbst, könnte man nur erst das Beharrungsvermögen des Irrtums brechen! Dann würde auch Schulzes Theorie von den Gefühlen bald anerkannt sein. Wenn er nur eine Methode gehabt hätte! Das Feinste ist bekanntlich die experimentelle Methode. Es ist eine Kleinigkeit, damit die Weite des Bewußtseins zu messen, warum nicht auch die Tiefe eines Gefühles oder die Höhe eines Ideals?
Während er so nachdachte, daß man ordentlich das Gehirn knirschen hörte, klopfte es an die Tür. In einen Mantel gehüllt, trat ein Mann ins Zimmer, setzte, grüßend, ein Kästchen auf den Tisch und nahm selbst in aller Ruhe auf einem Stuhle Platz. Man konnte nicht sagen, ob er alt oder jung sei; seine Stirn war so hoch, daß sie den Haaren fast keinen Platz mehr gelassen; aber unter den dichten Augenbrauen glänzten zwei helle, durchdringende Sterne.
Er ließ dem Philosophen keine Zeit, von seinem Erstaunen sich zu erholen, sondern begann: »Gestatten Sie mir, Herr Doktor, Sie mit dem neuesten Fortschritt der Wissenschaft bekannt zu machen. Ich bin nämlich Psychotom und augenblicklich auf der Reise, um meine Seelenpräparate abzusetzen; ich bin also sozusagen Reisender in philosophischen Effekten. Sie verstehen mich nicht recht? Ich sehe da einen Zweifel, erlauben Sie!«
Damit beugte er sich vor, griff vorsichtig mit zwei Fingern an das Haar des Philosophen und nahm, wie man jemand einen Käfer vom Rocke entfernt, einen kleinen Gegenstand heraus, den er auf den Rand des Tintenfasses setzte. Mit Verwunderung erkannte Schulze ein allerliebstes Figürchen, nicht höher als ein paar Zentimenter, das sofort an der Tinte zu nippen begann.
»Es ist die Kategorie der Negation«, sagte der Psychotom, »ich sah, daß sie Ihnen das Verständnis meiner Auseinandersetzungen erschwerte, deshalb entfernte ich sie. Die wohltätige Wirkung wird nicht ausbleiben.«
»Aber erlauben Sie ...«
»Bitte, Herr Doktor, Ihr Bedenken ist nur noch eine Nachwirkung, der Zweifel wird sogleich aufhören. Befürchten Sie nichts, ich setze Sie Ihnen wieder ein; inzwischen stärkt sie sich, denn Tinte ist ihr Lieblingsgetränk. Doch hören Sie weiter. Es ist Ihnen bekannt daß die Gehirn-Physiologie zu keinen sicheren Resultaten kommt. Wir haben daher einen anderen Weg eingeschlagen, wir sezieren das Bewußtsein selbst. Man muß die logischen Abstraktionen nicht bloß denken, sondern man muß sie realisieren, personifizieren. Das sei nichts Neues, wollen Sie sagen, das habe schon Platon getan. Aber hat er sie greifbar dargestellt, daß man mit ihnen umgehen kann? Mythologisch ja, aber nicht anschaulich. Sehen Sie, das ist das Problem: Auch die Funktionen des Bewußtseins müssen in der räumlichen Anschauung dargestellt werden, aber nicht, indem man das Gehirn zerstört, wie die Physiologen, sondern indem man die lebendige Wirkung in lebendigen Präparaten entwickelt. Es ist wahr, auch wir, die Psychotomen, können die Resultate unserer Zergliederung nur als sinnliche Dinge aufzeichnen, aber unsere Produkte sind nichts Unverständliches und Totes, sondern sie bewahren die charakteristische Eigenschaft des Bewußtseins, ein selbständiges, lebendiges Ich zu bleiben. Unsere Präparate sind selbst Personen, unvollständige freilich, denn sie sind ja nur Teile der vollen, menschlichen Persönlichkeit, aber sie sind doch lebendig und ein sonderbares Völkchen, das man mit Vergnügen studiert.«
»Das ist mir vollkommen klar«, sagte der Philosoph, »ich danke Ihnen. Sie haben offenbar eine Methode –«
»Lieber Herr Doktor«, unterbrach ihn der Fremde, »die Methode der Psychotomie kann ich Ihnen heute nicht entwickeln, begnügen Sie sich vorläufig mit den Resultaten. Ich habe die wesentlichsten mitgebracht.«
Damit öffnete er das Kästchen und entnahm ihm verschiedene Päckchen und Gläser.
»Zuerst einige Kleinigkeiten«, begann er wieder. »Das sind Dinge, mit denen wir unsere Fabrikation anfingen, ehe wir die eigentlichen Seelentätigkeiten darstellen konnten. Hier zum Beispiel haben Sie die berühmten platonischen Ideen.«
Er reichte ein versiegeltes Päckchen hin, das Schulze aufzuwickeln suchte.
»Ja«, rief der Psychotom, indem er ihm das Päckchen wieder fortnahm, »öffnen dürfen Sie es nicht. Die Ideen sind ohne materielle Umhüllung nicht sichtbar.«
»Aber dann weiß ich ja gar nicht, was in dem Papier ist.«
»Das müssen Sie mir eben glauben! Hier sind übrigens einige Atome von Demokrit, sie sind etwas zu groß geraten, ich will sie Ihnen schenken. Wir haben auch einige moderne Atome dargestellt, aber es ist kein Staat damit zu machen. Wofür halten Sie dieses kleine Universum in nuce? Es sieht niedlich aus zwischen den Nußschalen, nicht wahr? Nur etwas dunkel darin! Es ist nämlich eine Leibnizsche Monade, und die haben bekanntlich keine Fenster. In diesem Glase ist eine Rarität, die ich Ihnen aber etwas billiger lassen kann; es ist ein Stückchen von Kants reiner Vernunft.«
»Aber sie sieht grau aus.«
»Ja, sie ist etwas schmutzig geworden in den letzten hundert Jahren. Aber Sie können sie popularisieren lassen, dann wird sie wieder wie neu. Doch nun die Hauptsache!«
Er legte einen Teil der Gegenstände in den Kasten zurück; dabei fielen dem Philosophen einige seltsam geformte Bündel auf. »Was haben Sie da für merkwürdige Würstchen?« fragte er.
»Das sind Raumproben.«
»Raumproben?«
»Ja, es sind die Muster der verschiedenen Raumsorten, mit positivem und negativem Krümmungsmaß, von drei, vier, fünf und n Dimensionen. Wird nach den Dimensionen bezahlt, das Meter soundso viel. Ich will Ihnen einige Stückchen hierlassen.
»Aber dort der Pfeil und der Schildpattkamm?«
»Das sind zurückgesetzte Stücke› Kuriositäten fürs Schaufenster. Der Pfeil ist der bekannte eleatische, welcher ›im Fluge ruht‹, und der Kamm ist von der berühmten Schildkröte, die von Achill nicht eingeholt werden konnte. Jetzt aber wollen Sie achtgeben, hier ist das allein würdige Endziel der Psychotomie.«
Er stellte drei Gefäße vor den Philosophen. Das erste war ein durchsichtiges Glaskästchen, eingerichtet wie ein niedliches Puppenstübchen, in welchem sich eine ganze Gesellschaft von kleinen, in leichte Schleier gehüllten elfenartigen Figürchen bewegte. Schulze erkannte sofort in ihnen die Kategorien des Verstandes an der Ähnlichkeit mit der Kategorie der Negation, die schon ein erhebliches Stück aus seinem Tintenfasse getrunken hatte.
»Man sollte gar nicht denken«, sagte er, »daß gerade die Verstandsbegriffe, die man doch für das Trockenste in der Welt hält, eine so reizende Gestalt besitzen.«
»Ja, das ist seltsam«, bestätigte der Psychotom; »aber es erklärt sich aus der reinen und unvermischten philosophischen Abstammung, während andere Bewußtseinszustände, Gefühle und dergleichen aus dem gewöhnlichen Leben stammen. Und dann bedenken sie die weiblichen Charaktere, wie sie schon in den Namen Quantität, Realität, Negation, Kausalität und so weiter liegen. Hier ist eine Lupe, betrachten Sie sich die Negation näher. Ein freundliches Ding, nur mit den anderen verträgt sie sich schlecht. Ist jetzt billig zu haben, weil stark in Mißkredit gekommen. Was meinen Sie, was mir die Regierung gibt, wenn ich den Mitgliedern der Opposition die Kategorie der Negation herausnähme, so wie Ihnen? Sehen Sie hier das buntschillernde Fräulein, wie sie sich nach allen Seiten wendet? Das ist die Limitation. Sie macht, daß ein Ding weder das eine noch das andere ist, weder schwarz noch weiß, weder ja noch nein; wird bei Wahlen sehr verlangt. Hier haben Sie die Kategorie der Möglichkeit, bei Theologen stark gefragt, und ihre Zwillingsschwester, die Unmöglichkeit, die namentlich bei juristischen Verteidigern beliebt ist. Doch jetzt kommen wir zu den Gefühlen.« Er öffnete eine Büchse voll dunkler, schleimiger Kügelchen.
»Das ist ja Kaviar«, sagte Schulze.
»Es sieht so aus, aber es sind die präparierten Gefühle und Stimmungen. Sehen Sie näher zu, so erkennen Sie in jedem dieser kleinen Bläschen eine Art von Physiognomie. Sie sind freilich sozusagen niedere Organismen des Seelenlebens, aber eben darum die breite Basis des menschlichen Daseins. Glatt und schlüpfrig sind sie alle, denn unbeständig glitschen sie durcheinander. Sie denken, Sie haben die Freude in der Hand, und wenn Sie recht zusehen, ist es der Ärger. Übrigens hat man sie numeriert – hier ist das Verzeichnis –, denn es gibt ihrer zu viele. Ich verkaufe sie nicht einzeln, weil sie sich nur im ganzen halten; würde mir auch niemand den Schmerz, den Trübsinn, die Angst, den Kummer, den Hunger und die Ungemütlichkeit abnehmen wollen. Doch die Zeit drängt. Mit den Charaktereigenschaften will ich Sie daher nicht aufhalten, man findet sie heute nirgends rein. Aber dies müssen Sie noch sehen, das sind die ›Ideale.‹
»Die Ideale? Aber das sind ja Flüssigkeiten; ich hätte den Inhalt dieser Fläschchen für Likör gehalten.«
»Ja, sie sind in Spiritus, sie halten sich sonst nicht. Blicken Sie gegen das Licht, so sehen Sie schwach schimmernde, ätherische Gestalten auf und nieder steigen. Hier in diesem rötlichen Gefäße ist die Freiheit. Ich habe nur diese kleine Probe, denn ich konnte in ganz Europa nicht mehr davon auf treiben. Hier ist die Humanität, sie ist billiger, wird aber bloß noch von den Tierschutzvereinen verlangt. Dies ist die Unsterblichkeit; von ihr habe ich noch gar nichts abgesetzt, denn sie wird jetzt künstlich gemacht. Und jetzt, lieber Doktor, leben Sie wohl! Diese drei Sachen will ich Ihnen hierlassen. Betrachten Sie alles genau, aber mit Vorsicht, die Kategorien, die Stimmungen und die Ideale. Nahrung brauchen sie nicht; sollten die Kategorien zu unruhig werden, so setzen Sie sie auf eines Ihrer Manuskripte, um sie etwas auszuhungern. Und hier haben Sie noch eine Zugabe.«
Er setzte ihm ein Fläschchen hin, in welchem sich ein Figürchen befand, wie die kartesianischen Teufelchen.
»Was ist das?« fragte der Philosoph, der vor Überraschung kaum zur Besinnung kam.
»Der höhere Blödsinn«, antwortete der Psychotom. Damit war er verschwunden.
Schulze griff sich an den Kopf, stand auf, ging hin und her – nein, er träumte nicht. Er dachte an Betrug, vielleicht eine neue Methode von Langfingern, sich anzuschleichen, doch nichts fehlte im Zimmer. Da standen Kästchen, Büchse, Fläschchen, da lagen auch die Würstchen, welche Raumproben enthalten sollten: Auf dem Tintenfaß saß noch die Negation. Wie fatal! der Psychotom hatte vergessen, sie ihm wieder einzusetzen. Doch er wird wohl wiederkommen! Schulze ließ sie also sitzen, wo sie saß, zumal er keinerlei Unbehagen von ihrem Fehlen verspürte. Kaum getraute er sich die Seelenpräparate anzufassen und lüftete nur zögernd einen Augenblick den Deckel der Büchse mit den Stimmungen. Plötzlich sprang er auf. Er wollte hinaus, in der freien Luft sich zu erholen. Indem er die Treppe hinabstieg, stolperte er über den Hauskater und kam beinahe zu Fall. Er freute sich herzlich, dem guten Tierchen nicht wehe getan zu haben.
Als er aus der Tür trat und seine Handschuhe anziehen wollte, bemerkte er an der Hand ein dunkles Bläschen aus der Büchse der Stimmungen, das unbemerkt dort klebengeblieben war. Er erkannte darauf die Auszeichnung Nr. 1 und erinnerte sich, daß der erste Name in der Liste die Zufriedenheit gewesen sei. Nun, er war auch ganz zufrieden und steckte das Kügelchen in seine Streichholzbüchse.
Es war Tauwetter; der halbzerflossene Schnee lag naßkalt und schmutzig auf dem holprigen Pflaster, daß der Fuß bei jedem Tritt ausglitt. Der Nebel hielt das letzte Licht der Dämmerung ab, und da die Laternen noch nicht brannten, so konnte man nicht einmal recht sehen, wohin man trat. Schulze bat einen Müllerburschen um Entschuldigung, daß er an ihn angerannt sei, und freute sich über die Mehlspuren an seinem dunklen Überzieher, die im Nebel zu einem angenehmen Kleister zerflossen. Der Stadtrat Billig begegnete ihm, den er oft durch Tadel städtischer Verwaltungsmaßregeln geärgert hatte.
Schulze sprach ihn an, begleitete ihn.
»Ein Hundewetter«, sagte der Stadtrat. »Diesen Schnee wieder hinauszuschaffen kostet der Stadt –«
»Freilich«, unterbrach ihn Schulze, »das bringt Geld unter die Leute, aber es ist auch ebenso schön, wenn er liegenbleibt. Die Unebenheiten des Pflasters erhöhen durchaus den Reiz der Gegend, und ihre Ausfüllung mit Schnee ist ein sehr belehrendes Bild für die ausgleichende Tätigkeit der Natur. Jeder Patriot kann es nur billigen, wenn der Naturzustand unserer Stadt erhalten bleibt.«
»Ich will nicht hoffen, Herr Doktor, daß Sie Ihren Spott –«
»Herr Stadtrat, ich versichere Sie, daß ich mich durchaus in unseren Verhältnissen wohl fühle. Ich wünsche, jeder Bürger sähe die Notwendigkeit ein, daß die Beschwerden des Weges als Erziehungsmittel der Menschheit zu pflegen sind. Diese Dunkelheit der Straßen schärft die Sinne der Fußgänger und Kutscher, sie kommt nicht bloß der Stadtkasse zugute, sondern unter Umständen auch den Ärzten und Chirurgen. Wieviel Eitelkeit, wieviel Putzsucht, wieviel unnötiger Toilettenaufwand werden dadurch unterdrückt, daß unsere Damen von vier Uhr an nicht mehr gesehen werden können. Wenn ich Stadtverordneter wäre –«
»Sie müssen es werden, Herr Doktor, Ihre Hand darauf!«
»Gewiß, mit dem größten Vergnügen. Es gibt keine Vorlage, der ich nicht unbedingt zustimme.«
»Auch dem neuen Aufschlage zur Kommunalsteuer?«
»Selbstverständlich. Es kann nie Steuern genug geben, denn nichts ist erhebender, nichts erfreulicher, nichts beglückender, als sein. Hab und Gut zum Besten der Gemeinsamkeit zu opfern.«
»Bravo! Bravo! Ich gehe an meinen Stammtisch in der ›Roten Tulpe‹; noch heute sichere ich Ihnen zehn Stimmen. Auf Wiedersehen!«
Der Stadtrat empfahl sich begeistert. Auch Schulze fand den Gedanken an seine akademische Stammecke nicht übel und schlug die bewußte Richtung ein. Er war noch nicht weit gelangt, als er einer Dame begegnete, deren Beredsamkeit er sonst in großem Bogen auszuweichen pflegte. Heute kam sie ihm, soweit es die Dunkelheit gestattete, in rosigem Licht vor. Linolinde v. Zwinkerwitz hatte allerdings Rot aufgelegt. Seit zehn Jahren – solange nämlich war Schulze Privatdozent – behauptete sie, daß er ihr den Hof mache, und ebensolange zwang sie ihn bei jeder Begegnung zu einer längeren Aussprache. Schulze pflegte zu klagen, er habe auf diese Weise schon zwei ganze Semester verloren – das Semester zu drei Monaten, den Monat zu zwanzig Tagen und den Tag zu anderthalb Stunden gerechnet –, so lange nämlich dauerte sein Kolleg über die Geschichte der griechischen Philosophie vor Sokrates. Jetzt aber war Linolinde ganz entzückt von Schulzes Liebenswürdigkeit, und gerührt gestand sie ihm, daß sie eine Novelle geschrieben habe, nur einige hundert Seiten. Ob er sie nicht einmal durchlesen wolle.
»Mit dem größten Vergnügen, teuerstes Fräulein! Wie freue ich mich auf den Genuß, einen Blick in das Leben Ihrer schönen Seele zu tun! Wie werde ich den Helden beneiden, den der Hauch Ihres Genius mit dem ganzen Farbenzauber Ihrer Liebe geschmückt hat!«
»Ja«, rief Linolinde, »Sie erraten meine Gefühle! O dieser Scharfsinn der Philosophen! Ach, ich wage es nicht – nein, ich darf Ihnen meine Novelle nicht geben! Wenn ich mich getäuscht hätte –«
»Es gibt keine Täuschung für die wahre Dichterin. Zweifeln Sie nicht an dem treuen Verständnis, das ich den Gefühlen Ihres Helden entgegenbringe.«
»Aber Sie wissen nicht –«
»Ich weiß, daß ich zufrieden bin.«
Linolinde schwieg. Sie waren auf die Promenade gekommen, die rote Laterne blinkte in der Nähe. Linolinde ging immer weiter. »Sie gehen noch länger hier spazieren?« fragte sie. Schulze hatte das Gefühl, daß er dies eigentlich nicht wolle, es zog ihn nach der Laterne, aber er konnte nicht nein sagen. So schritt er weiter, Linolinde neben ihm. In Gedanken verloren, kehrte er am Ende der Promenade um, Linolinde desgleichen. Sie sprachen noch immer nichts. Linolinde glitt aus – ein leichter Schrei –, dann nahm sie den Arm, den er ihr darbot.
»Die Glätte«, sagte er, »ist die vornehmste und die holdeste Eigenschaft der Körper, sie ist die Stufe, über welche die Materie zur Idee schreitet; darum hielt Epikur die Seelenatome für
das Glätteste. Nicht ohne Grund alliteriert der Sprachgeist Glätte, Glaube, Glück.«
Linolinde drückte leise seinen Arm und hauchte: »Warum sollen wir uns nicht sagen, daß wir uns verstehen?«
»Wir verstehen uns«, erwiderte er. Da hing Linolinde an seinem Hals, dank der Sparsamkeit des Stadtrates im Dunklen auf der menschenleeren Promenade, zwanzig Schritt von der roten Laterne. Ein Räuspern ward vernehmbar, Schritte ... »Auf Wiedersehen!« Linolinde entschwand. Schulze trat seelenvergnügt in sein Stammlokal, wo er an der Tür mit seinem Spezialkollegen, dem Professor Oberwasser, zusammentraf.
Es wurde ein bedenklicher Abend für Schulze, denn er konnte niemand etwas abschlagen. Für den folgenden Morgen versprach er dem Geologen, ihn auf einer den ganzen Tag dauernden Exkursion zu begleiten, zugleich aber seinem Nachbarn zur Linken, ihm um 12 Uhr auf der Bibliothek eine Auskunft zu geben, und nachdem die beiden fortgegangen, nahm er von einem später Angekommenen für dieselbe Zeit eine Einladung zum Frühstück an. In bezug auf seine Reiseerinnerungen, die zur Sprache kamen, verstrickte er sich in ein unendliches Netz von Lügen, weil er auf keine Frage nein zu sagen vermochte, und zuletzt kam er in Streit mit seinem Kollegen Oberwasser wegen der bekannten literarischen Fehde, in welche dieser mit dem berühmten Philosophen Weißschon über die Anschaulichkeit des reinen Nichts geraten war.
»Kann ein vernünftiger Mensch«, so rief Oberwasser entrüstet aus, »es für möglich halten, daß die pure Aufhebung eines Begriffes als solche noch Merkmale der Distinktion innerhalb der Grenzen der Sensibilität, obschon durch bloße Abstraktion gegeben, vermittels der Negation dieser Abstraktion zur repulsiven Konkretion determiniert, ihrerseits durch Nichtsetzung des Nichtseins erlangen könne?«
Selbstverständlich erwartete er ein ebenso entrüstetes »Nein« aus Schulzes Mund; aber zu aller Erstaunen sagte dieser:
»Allerdings ist das Nichts durchaus positiv, insofern ich es nämlich nicht verneinen kann. Was aber Ihre Abhandlung betrifft, an die ich mit dem größten Vergnügen denke, so kann ich nur sagen, daß Sie ebenso recht haben wie Weißschon, weil überhaupt alle Urteile aller Menschen unter allen Umständen bejahend sind.«
Da stand Oberwasser indigniert auf und ging in der Überzeugung fort, daß Schulze zuviel getrunken habe. Das war nun zwar nicht der Fall, aber es kam noch, als auch die übrigen Kollegen sich davongemacht hatten. Sooft ihn nämlich der Kellner fragte, ob er noch ein Glas befehle, war er nicht in der Lage, nein zu sagen; außerdem schmeckte es ihm vorzüglich. Mit den Vorschlägen der Speisekarte ging es ihm ebenso, leider aber auch beim Bezahlen, da er auf jede Kontrolle verzichtete. Es war spät geworden, als er nach Hause ging, und unterwegs hatte er noch einen kleinen Aufenthalt mit dem Nachtwächter, weil er behauptete, es gäbe nichts Schöneres, als in einer naßkalten Schneenacht mit dem Spieße in der Hand in einer Mauerecke zu lehnen.
Als Schulze später am Vormittage erwachte und sich vergeblich bemühte, das gestern Erlebte in sein Gedächtnis zurückzurufen, bemerkte er plötzlich auf dem Stuhle vor seinem Bett den Kater seiner Wirtin, der ihn mit ernster und, wie es schien, mißbilligender Miene betrachtete. Aber wie erschrak er, als er zwischen den Vorderpfoten des Tieres seine Kategorie der Negation entdeckte, die dasselbe offenbar für einen Vogel oder dergleichen gehalten und gefangen hatte. Unwillkürlich machte er eine Bewegung nach dem Stuhle; da begann plötzlich der Kater mit vernehmlicher Stimme zu sprechen:
»Bleiben Sie ruhig liegen, sehr geehrter Herr Doktor, wundern Sie sich auch nicht, daß ich rede. Meine berühmten belletristisch-epischen Vorfahren hatten dazu geringere Motive als ich, denn ich habe in dieser Nacht sämtliche Kategorien auf Ihrem Schreibtische gefressen.«
»Beim heiligen Immanuel!« schrie Schulze. »Wieviel waren es?«
»Ich habe sie leider nicht gezählt« – Schulze seufzte tief, während der Kater fortfuhr – »und bedaure in der Tat, daß somit die berühmte Streitfrage über die Zahl der Kategorien nicht geschlichtet werden kann. Aber da ich nun einmal den Verstand, wenn auch nicht mit Löffeln, so doch in ausreichender Portion gefressen habe, so erlaube ich mir, Sie ganz ergebenst darauf aufmerksam zu machen, daß Sie versäumt haben, Herrn Professor Steinschleifer zur geologischen Exkursion abzuholen, daß Sie jetzt um zwölf Uhr nicht auf der Bibliothek sind, endlich auch die Einladung zum Frühstück nicht abgesagt haben.«
Schulze nickte wehmütig. »Leider, leider, die Herren werden es mir sehr übelnehmen. Aber geben Sie mir, lieber Herr Hinze, meine Kategorie der Negation wieder.«
»Geduld«, sagte der Kater. »Ich will Ihnen nur noch bemerken, daß Sie Herrn Oberwasser, dessen Stimme in der Fakultät bekanntlich ausschlaggebend ist, schwer beleidigt haben. Mit dem Extra-Ordinarius wird es nun wohl wieder nichts sein. Daß Ihr Feuerzeug verloren, Ihre Börse leer und Ihr Überzieher ruiniert ist, das sind demgegenüber nur kleinere Unannehmlichkeiten. Außerdem sind hier noch einige Briefe eingelaufen, die ich Ihnen nicht vorenthalten will.«
»Immer zu«, sagte Schulze, ergeben in sein Schicksal.
»Herr Stadtrat Billig schreibt Ihnen, daß Ihre Wahl zum Stadtverordneten gesichert sei« – hier stieß Schulz einen Schrei des Entsetzens aus – »und daß Ihre opfersinnigen Äußerungen ihn ermutigt hätten, in der Einschätzungskommission Ihre Erhöhung um drei Steuerklassen vorzuschlagen. Sodann ist hier eine Vorladung betreffend Vernehmung in Sachen Beleidigung des Nachtwächters Warmbier. Weiterhin ist hier ein dickbändiges Manuskript: ›Herzensnacht und Strahlenmacht‹, Novelle von Linolinde von Zwinkerwitz, und von derselben Hand ein ebenso starker Essay: ›Über die Unsterblichkeit der Seele, Gedanken einer Lebendigen‹. Dazu ein Briefchen: ›Teurer Freund! Nicht wahr, Sie lesen noch heute? Ort und Stunde wie gestern, wo Ihr Urteil zitternd erwartet L. v. Z.‹«
Schulze rang die Hände.
»Endlich«, sagte der Kater, »ist noch ein Briefchen hier von derselben Hand. Es lautet: ›Geliebter! Ich habe Mama alles gestanden. Sie erwartet Dich heute mittag. Ich schwelge im Glück! Ewig die Deine – Linolinde‹.«
»Mein lieber Herr Schulze«, fuhr der Kater fort, »wenn Sie ein andermal die Zufriedenheit mitnehmen, dann lassen Sie jedenfalls die Negation nicht zu Hause. Ich habe die Ehre, sie Ihnen wieder zu überreichen.«
Bei diesen Worten nahm der Kater mehr und mehr die Züge des Psychotomen an – auf einmal fühlte Schulze einen lebhaften Druck an seinem Kopfe und verlor zugleich die Kategorie und den Kater aus dem Gesichte. Schnell sprang er auf, fuhr in die Kleidung, kühlte sein Haupt und trat in sein Studierzimmer.
Auf der Schwelle lag sein Stubenhündchen, der treue Nonsens; aus seinem Maule hing noch eines der Würstchen mit den Raumproben. Das gute Tier hatte sie für genießbar gehalten, da waren ihm die Koordinaten in seinem Leibe auseinandergegangen, und nun lag es, nach allen Dimensionen gekrümmt, regungslos zu den Füßen seines Herrn. Schulze hob es bedauernd auf, da sagte eine Stimme:
»Laß mal liegen, Schulze, er ist nur scheintot.«
Und so war es. Als richtiger Philosophenhund mußte er die Metageometrie bald als unverdaulich wieder von sich geben.
Der Redende war Schulzes bester Freund, Dr. Müller, ein normal entwickelter Mediziner, der es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatte.
»Du siehst übrigens jammervoll aus, Mensch«, fuhr er fort, »es tut mir leid, daß ich dir nicht einen Löffel Kaviar übriggelassen habe. Aber er war ausgezeichnet. Wer hat dir den gestiftet?«
»Um Himmels willen, Müller, du hast diese Büchse hier geleert?«
»Mit dem besten Appetit; du nimmst es doch nicht übel? Ich habe auch diese Likörproben dazu getrunken, etwas kräftig, aber delikat.«
»Unseliger Mensch, das waren ja meine Gefühle, das waren meine Ideale! Du hast sämtliche Gefühle und Ideale der Menschheit verschlungen, Kannibale, was soll nun aus dir werden?«
»Gefühle im Kaviar und Ideale im Schnaps? Ihr Philosophen seid praktischer, als man meinen sollte. Nun, du siehst, es hat mir nichts geschadet. En richtiger Mediziner wird von solchen Kleinigkeiten nicht angegriffen. Hier hast du übrigens dein Feuerzeug wieder, es lag auf der Treppe. Ei, laß doch sehen, da ist ja noch so ein Störei; aber wahrhaftig, das Ding sieht gelungen aus –«
»Heb es auf, es ist die Zufriedenheit.«
»Es scheint mir eine neue Parasitenform, ich will versuchen, eine Reinkultur anzulegen. Und nun erzähle, wie du dich so zugerichtet?«
Schulze beichtete. Da fühlte der Arzt ihm den Puls und sagte:
»Menschlein, du hast noch nicht ausgeschlafen, nachmittags wird dir besser sein. Sei übrigens froh, daß der Kater und ich das Zeug gegessen haben, dir wäre es jedenfalls schlechter bekommen. Du kannst mir noch eine Zigarre geben, vorausgesetzt, daß nicht irgendein psychologisches Scheusal mit eingewickelt ist.«
Er zündete die Zigarre an und ging gemütlich grüßend von dannen. Schulze aber setzte sich an den Schreibtisch, tauchte die Feder in das Tintenfaß, das die Negation halb ausgetrunken hatte, und schrieb Absage- und Entschuldigungsbriefe. Und da sich einmal seine Kategorie der Negation mit Tinte gesättigt hatte, schrieb er gleich noch eine Rezension hinterher. Dann stützte er das schwere Haupt wehmütig in die Hand und gedachte unter Seufzen des Psychotomen und seiner unglückseligen Gaben. Alle waren verschwunden – doch nein! Ein Gläschen stand noch in der Ecke, und ein Teufelchen schaute ihn unverfroren an.
Es war der höhere Blödsinn.
Heino Mirax hatte eben in der Zeitschrift »Mysterium – Organ für übersinnliche Weltanschauung und Experimental-Metaphysik« einen seiner tiefsinnigsten Artikel veröffentlicht:
Ȇber die Anwendung der Entwicklungstheorie
auf die künstliche Züchtung der Weltseele.«
Man fand denselben epochemachend überall, wo man überzeugt war, daß die moderne Wissenschaft auf dem Holzwege sei. Daß sie sich in der Tat auf dem Holzwege befindet und umkehren muß, ergibt sich für einen Kopf, der nicht durch gelehrte Studien gründlich verdorben ist, äußerst einfach. Es ist nämlich ungemein schwer, den gesamten Gedankenvorrat richtig zu verdauen, den die Geistesarbeit von Generationen unter dem Namen der Wissenschaft angehäuft hat. Der Mensch möchte doch aber gern etwas vom tiefsten Wesen der Welt verstehen, ohne ein halbes Leben lang darüber zu studieren. Da es nun nicht mehr möglich ist, beim Zeitunglesen nebenbei zur Wissenschaft zu gelangen, so muß die Wissenschaft zum Menschen kommen, der so beschränkt in seiner Zeit ist; das heißt, sie muß umkehren, sie muß wieder einfach werden, so einfach, daß ein jeder sie versteht, der nur hin und wieder einen Blick in ein Journal wirft.
Es ist eines der gelehrten Vorurteile, die endlich ausgerottet werden müssen, daß es schwierig sei, eine Wissenschaft zu reformieren. Man braucht dazu weiter nichts als einige Prinzipien und eine Methode.
Heino Mirax hatte beides.
Als Prinzipien nahm er irgendwelche beliebigen Sätze aus dem täglichen Leben, aus dem Sprichwörter- oder Märchenschatze der Völker oder aus einer der umzukehrenden Wissenschaften, vorausgesetzt nur, daß sie niemand bezweifeln konnte. So zum Beispiel: »Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist«, oder: »Ein Tischleindeckdich, wäre eine schöne Sache«, oder auch den ziemlich feststehenden Satz: »Die lebenden Wesen sind in einem allmählichen Vervollkommnungsprozeß begriffen.«
Seine Methode bestand darin, daß er diese Sätze auf ein beliebiges fremdes Gebiet anwandte, nur mit der Vorsicht, daß man auf keine Art nachweisen konnte, ob sie dort auch anwendbar wären. Darin lag eben das Neue, wodurch er die schwierigsten Rätsel des Daseins mit Leichtigkeit löste. So bewies er zum Beispiel, daß es auf der Sonne Bewohner gäbe, welche sich von Meteorsteinen nährten. Denn da man das Eisen schmieden muß, solange es heiß ist, da aber die Spektralanalyse nachweist, daß es auf der Sonne glühende Eisendämpfe gibt, so muß es auch Wesen auf der Sonne geben, die das Eisen schmieden; und da ein »Tischleindeckdich« eine hübsche Sache ist, so steht zu vermuten, daß jene Wesen auch gern vom Himmel gefallene Speisen haben möchten. Nun fallen aber die Meteorsteine vom Himmel und bestehen aus Eisen – folglich sind sie die Lieblingsspeise der Sonnenbewohner. Da endlich wir Menschen noch nicht Eisen verdauen können, die lebenden Wesen jedoch in einer Fortentwicklung begriffen sind und endlich die Sonne älter ist als die Erde, so folgt daraus: 1. Die Sonnenbewohner sind höherorganisierte Wesen als die Menschen; 2. die Menschen werden später dazu kommen, Eisen zu verdauen; 3. in einer – allerdings noch weit entfernten – Zukunft wird man zum Nachtisch den Gästen Granaten in den Mund schießen. Es muß freilich hinzugefügt werden, daß die letzte Folgerung nicht von allen Anhängern des Heino Mirax zugegeben wurde und daß sie auch in der Tat nicht ganz unbedenklich ist; die Neu-Miraxianer, die sie leugnen, haben möglicherweise recht. Aber auf Grund der beiden ersten Sätze hatte sich Mirax eine zuverlässige Schule geschaffen, welche alle umfaßte, die das Bedürfnis hatten, etwas bisher gänzlich Unbekanntes durch eine unbefangenere Logik zu erfahren. Sie erklärten Heino Mirax für einen der tiefsinnigsten und zugleich klarsten Denker aller Zeiten. Er sich auch.
Aber Mirax führte nicht nur die Naturforschung neue Wege, er brachte auch die Philosophie in erstaunlichen Schwung. Es ist unleugbar, daß ein Faß Wein nicht ausläuft, wenn man nur ein einziges kleines Loch hineinbohrt; daß dagegen der ganze Inhalt ausströmt, wenn man dem Fasse den Boden ausschlägt. Auch muß zugegeben werden, daß das Gedächtnis gewissermaßen das Gefäß ist, welches das Gesamtwissen der Menschheit zusammenhält. Mirax berief sich in dieser Hinsicht auf Kant und Goethe, und man weiß, daß Mirax ein Kenner dieser nicht unbedeutenden Schriftsteller ist. Das lächerliche Geschrei einiger Professoren, daß sich ein solcher Ausspruch weder bei Kant noch bei Goethe finde, noch auch nach der ganzen Eigenart dieser Geister bei ihnen sich finden könne, ist, als lediglich dem Brotneid entstammend, kurzerhand zurückzuweisen. Man darf zuversichtlich erwarten, daß kein Miraxianer die Schriften jener Männer selbst nachlesen wird. Mit Hilfe der beiden obigen Prinzipien schloß Mirax, daß, wenn man nur in das Gedächtnis der Menschheit ein genügend großes Loch schlagen könnte, sofort der gesamte Wissensinhalt auslaufen würde. Man müßte ihn alsdann auffangen und auf Flaschen ziehen. Darauf wollte er seine neue Pädagogik gründen und so die Erziehung der Menschheit endlich in Ordnung bringen. Die Zeitschrift »Mysterium« veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, worin mit Repliken und Dupliken heftig gekämpft wurde, welche Gestalt die anzuwendenden Geistflaschen haben sollten; es ist bedauerlich, daß darüber Streit entstehen konnte, da die altdeutsche Form des »Nürnberger Trichters« zweifellos die einzige ist, die der nationalen Würde entspricht. Hoffentlich nimmt der Staat bald die Sache in die Hand.
Nicht zufrieden mit seinen bisherigen Erfolgen, gedachte Heino Mirax nunmehr die Weltentwicklung überhaupt in beschleunigtere Gangart zu versetzen. Längst hatte er erkannt, daß die Schwäche der modernen Naturwissenschaft in ihrer Beschränkung auf die Gesetze der stofflichen Welt bestehe. Mit dem Ausmessen und Berechnen der Sternbahnen, der Erforschung von Land und Meer, dem Abwägen von Kohlenstoff und Sauerstoff, mit der Beobachtung der Nervenprozesse, der Zellenbildung, der organischen Fortpflanzung – mit alledem flickt man ja doch nur an dem äußeren Gewande der Natur herum. Man mag dadurch die materielle Welt beherrschen, aber man lenkt sie nur künstlich wie ein Pferd am Zügel, nicht durch die Anfeuerung des inneren Triebes. Mirax ging tiefer; er beschloß, die Weltseele selbst zu züchten.
Es ist einleuchtend, daß die gesamte Natur ebensogut wie der Mensch ein inneres Bewußtsein, ein Gefühl ihrer selbst besitzt. Die alten Griechen bis Plato waren darüber nicht im Zweifel gewesen; erst die moderne Wissenschaft seit Descartes und Galilei hatte es vergessen. Nicht so Mirax; er griff der Natur in den Busen, von innen heraus wollte er sie fördern. Man sage nicht, daß eben der Körper das einzige sei, wodurch der Geist zugänglich und anderen vermittelt werde. Die Experimente über den körperlosen Verkehr der Geister haben diese Ansicht widerlegt; das Hellsehen und der Spiritismus bilden von nun ab die Mittel, der Natur nicht mehr auf den Leib, sondern direkt auf die Seele zu rücken. »Der Darwinismus muß spirituell werden!« Mirax sprach das große Wort gelassen aus.
Noch mehr! Die Weltseele muß künstlich gezüchtet werden! Nicht mehr die Naturkräfte – Licht und Wärme – und die Naturerscheinungen - Sternenhimmel, Atmosphäre, Erdrinde – dürfen das Objekt der Wissenschaft bilden, sondern die Naturseelen, die Geister, welche die Innenseite dieser Kräfte und Erscheinungen repräsentieren. Unmittelbar auf die Elementargeister sollte man wirken, in ihnen den Trieb nach Vervollkommnung wecken und durch künstliche Auslese, Zuchtwahl und Vererbung – denn warum sollen nicht auch die Geister sich fortpflanzen? – sie zu einer gedeihlichen Entfaltung ihrer Kräfte bringen. Man braucht dann nicht mehr die Gesetze der Elektrizität mühsam zu studieren; man ruft den Geist derselben - nennen wir ihn Elektra – und veranlaßt ihn, uns ohne Strom und Funken zu dienen. Schon Faust hatte etwas Ähnliches gewollt, als er seine Geister beschwor; aber in jenem dunklen Zeitalter fehlten ihm noch die Mittel zur richtigen Durchführung, und deshalb hätte Goethe auch besser getan, den Faust nicht zu schreiben.
Mirax wußte die Sache methodischer anzufassen. Das Darwinsche Grundgesetz von der fortschreitenden Entwicklung der Organismen steht fest. Beruht nun diese Entwicklung auf dem mechanischen Einflüsse der Naturkräfte? Da hat Häckel offenbar vorbeigeschossen; das Bewußtsein selbst ist es, welches zu entfalten ist! Mirax wandte das Entwicklungsgesetz auf die Elementarseelen an. Der Erdball hat eine Seele. Nur steht sie nicht, wie Fechner glaubte, höher, sondern tiefer als wir. Wenn es nun gelänge, die Erdseele zu erziehen, zu entwickeln von innen heraus, welche Fülle von irdischem Fortschritt müßte sich ergeben! Was nützt das Herumgraben und Analysieren in der gravitierenden Masse, die man Materie nennt! Das Ursprüngliche ist der psychische Zustand, das Bewußtsein, und diese Erde ist nur eine niedre Form, eine untergeordnete Seinsart des Geistes.
Mirax zog die Konsequenz der neuesten Entdeckungen, indem er Spiritismus und Darwinismus zum metaphysischen Monismus oder sogenannten Mystotranszendentalismus verband. Wir Menschen sind die höchste Stufe der Wesensreihe, weil wir es bis zur Entwicklung des Selbstbewußtseins gebracht haben, zum Unterschiede von Ich und Welt, der wir gegenüberstehen. Jene niederen Geister, wie zum Beispiel der Erdgeist, den die Geologen Erdrinde oder Lithosphäros nennen, sind noch nicht soweit. Sie haben ebenfalls Bewußtsein, aber sie sind bloßes Subjekt; sie erleben alles nur als wechselnde Zustände, ohne zu wissen, daß sie selbst es erleben, daß sie etwas sind und etwas vermögen. Wenn der Erdrindengeist zum Beispiel es dazu brächte, Selbstbewußtsein zu erlangen, so würde er dem Menschen ebenbürtig, ja durch die Größe und Mannigfaltigkeit seines Körperbaues – der Erdrinde – ihm vielleicht überlegen sein. Und wenn auch die Menschheit darüber zugrunde ginge, ihr Wesen selbst, die höhere Stufe des geistigen Seins, würde als Idee in dem zum Selbstbewußtsein gekommenen Erdgeiste fortleben; er würde den Weltprozeß dort weiter denken, wo die Menschheit ihn abgebrochen hat.
Das ungefähr war der Gedankengang, welchen Heino Mirax in seinem Artikel »Über die Anwendung der Entwicklungstheorie auf die künstliche Züchtung der Weltseele« durchgeführt hatte. Jetzt kam es nur noch darauf an, einen Elementargeist, also etwa den Geist der Erdrinde, zu veranlassen, daß er sich selbst über seine vielversprechende Zukunft aufkläre. Hätte er erst einmal eingesehen, daß ihm bloß das Selbstbewußtsein fehle, um in die höhere, ja die höchste Stufe des Geisterreichs einzurücken, so würde er sicher alles daransetzen, um zum Selbstbewußtsein zu gelangen. Welcher Erfolg, wenn Mirax diese künstliche Züchtung einer Seele der Natur zustande brächte!
Sollte es nicht genügen, daß der Erdgeist Gelegenheit bekäme, die Abhandlung unseres Denkens zu lesen? Daß er ein niederer Geist ist, der vielleicht gar nicht lesen kann; macht dabei nichts aus. Denn die Elementargeister sind, wie Mirax zweifellos festgestellt hat, nicht niedere Geister in dem Sinne, wie zum Beispiel die Hunde es sind, welche im allgemeinen das Lesen nie lernen; sondern niedere Geister sind sie nur im mystotranszendentalen, nicht im organischen Sinne, sie sind ganz menschlicher Art, wie die Spirits, nur daß sie eben kein Selbstbewußtsein besitzen. Das ist gerade das Feine am Miraxianismus, daß er den bisher nur bekannten organischen durch den mystotranszendentalen Unterschied ersetzt hat, und wer das nicht versteht, der ist nicht wert, daß die Wissenschaft um seinetwillen umkehre.
Um sich seiner Sache zu vergewissern, ließ Mirax noch den Geist des großen Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim zitieren, der sogleich erschien und ihm eröffnete, daß in der Tat der Erdrindengeist Lithosphäros ein Freund guter Lektüre sei. Die Einwirkung durch die Presse sei nicht nur für die politische Volksbildung, sondern auch für die mystotranszendental entwicklungstheoretische Erziehung der Elementargeister der passendste und wirksamste Weg. Darum habe er auch seiner Zeit deutsch geschrieben. Aber die Adresse des Erdgeistes wußte er ihm nicht anzugeben. Das sicherste sei, wenn Mirax mehrere Separatabzüge seiner Abhandlung in die tiefsten Bohrlöcher der Erdoberfläche hinabwerfen lasse. Heino Mirax fand zwar dieses Mittel etwas materialistisch; aber da es ein Experiment an wertlosen Objekten war, konnte er es ja einmal probieren.
Der Erdgeist stand gerade in seinem Kasino auf der Kegelbahn und hatte soeben eine Kugel geschoben, daß sämtliche Porzellantassen in Mitteleuropa klapperten und die Geologen nach ihren Seismographen liefen, um zu sehen, ob es auch wirklich gebebt habe. Es waren da bei ihm noch einige außer Dienst gestellte Elementargeister, nämlich die pensionierten griechischen Götter Poseidon und Hephästos, welche aus Ärger über ihre Verbannung von den Menschen jetzt dem Erdgeist im Kasino das Bier abgewannen; ferner ein abgestorbener Geysir aus Island und ein alter, ausrangierter Gletscher, der mit der Zeit nicht mehr fortkommen konnte und deswegen zurückgegangen war. Diese Herren bildeten das Kegelkränzchen des Erdrindenkasinos, und es war recht gemütlich dort; denn sie sprachen alle nicht viel. Die Götter schwiegen, weil sie nicht Deutsch verstanden und die anderen nicht Griechisch. Der Geysir war heiser, denn seine Luftröhre saß ihm voll Kieselsinter; und der Gletscher hatte Schmerzen in seiner Stirnmoräne, woraus durch Mißverständnis des Geologischen der Name Migräne entstanden ist. Der Erdgeist sagte auch nichts, weil ihm nichts einfiel; aber er bezahlte, sooft er verlor, und das war die Hauptsache.
Als sich der Erdgeist aus seiner Keglerstellung wieder aufrichtete, stieß er mit dem Kopfe an eine stählerne Röhre, die inzwischen aus der Decke hervorgedrungen war.
»Potz Glimmer!« schrie er, indem er die Spitze des Hohlbohrers abbrach. »Was sich nur da oben für ein Gesindel breitmacht, das einem aller Ecken und Enden die Haut durchsticht!«
»Das ist vielleicht so ein Kabel«, sagte der Gletscher, »wie sie es dem Vetter Meergreis um den Leib gelegt haben. Es soll gut gegen Rheumatismus sein.«
»Der Meergreis ist ein Esel«, murmelte Poseidon. Aber weil er auf griechisch murmelte, so meinten die anderen, es wäre etwas sehr Schönes, und gaben ihm ganz recht.
»Ich bin mit einem Seehund befreundet«, krächzte der Geysir; »der ist dort oben wohl bewandert; man sagt sogar, er sei ein Organismus, und als solcher –«
»Was ist denn das, ein Organismus?« fragte der Erdgeist.
»Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls etwas sehr Vornehmes; denn er hat Verkehr mit den Zweibeinern, welche Sie in die Haut gestochen haben.«
»Wenn das ist«, sagte der Erdgeist und sah den Geysir wegen seiner hohen Bekanntschaft mit Interesse an, »so fragen Sie ihn nur einmal, was sich gegen das Krabbeln und Stechen in meiner Rinde tun läßt.«
Dabei betrachtete er das abgebrochene Stück des Bohrers näher und bemerkte ein Papier in der Höhlung. Er zog es hervor und entfaltete die Abhandlung von Heimo Mirax mit der Widmung: »Herrn Erdrindengeist Lithosphäros hochachtungsvoll der Verfasser«. Das gefiel ihm, und er setzte sich sogleich auf sein Sofa, zündete ein Petroleumlager an und las, während die andern weiterkegelten.
Mirax hatte die schöne Eigenschaft, so zu schreiben, daß sich jeder bei der Lektüre seiner Aufsätze etwas dachte, und zwar allemal das, was ihm gerade in sein Behagen paßte; das war eben die neue Methode der reformierten Wissenschaft, und ihr verdankte er seine Beliebtheit. So dachte sich auch der Erdgeist das Seine und schmunzelte.
Er las die Abhandlung zu Ende, legte sie dann unter seine Steinkohlenpresse und sagte: »Selbstbewußtsein also ist's, was mir fehlt! Es ist mir nur lieb, daß ich das weiß; es war mir schon immer klar, daß ich noch zu etwas Höherem bestimmt sei. Ich brauche mir also nur das Selbstbewußtsein zu verschaffen. Wenn ich doch auch das noch wüßte, was das Selbstbewußtsein ist und wie man's bekommt! Meine Herren, weiß keiner von Ihnen, was das Selbstbewußtsein ist?«
»Wenn Sie mir nicht sagen können, wie das auf griechisch heißt, so kann ich Ihnen nicht helfen«, meinte Poseidon.
»Wenn mir nur meine Stirnmoräne nicht so weh täte«, rief der Gletscher, »dann würde ich's gewiß wissen.«
»Ich bin mit einem Seehund befreundet«, grunzte der Geysir, »der ist sogar ein Organismus –«
»Das ist wahr«, schrie der Erdgeist erfreut, »kommen Sie mit, wir wollen Ihren Seehund fragen. So ein Organismus muß das doch wissen.«
»Und er hat auch Verkehr mit den Zweibeinern«, setzte der Geysir hinzu.
Sie kamen zu dem Seehund; der hatte sich gerade gewaschen, lag auf einer Eisscholle und philosophierte, das heißt, die ganze Welt kam ihm als angenehme psychische Tatsache vor.
»Das ist hier der Herr Lithosphäros, Geist der Erdrinde«, stellte der Geysir vor. »Sie würden, lieber Freund, mich sehr verbinden, wenn Sie ihm sagen wollten, was Selbstbewußtsein ist. Da Sie doch ein Organismus sind –«
»Was, Organismus?« unterbrach ihn der Seehund unwillig. »Ich bin sogar ein Wirbeltier, und ich würde, wenn nicht die klimatischen Verhältnisse so ungünstig wären, ohne Zweifel schon längst zur Menschenwürde avanciert sein. Ich habe, wie Sie wissen, Umgang mit –«
»Entschuldigen Sie vielmals«, sprach der Erdgeist, »wir wissen wohl, daß Sie mit Zweibeinern verkehren. Sie können mir daher gewiß sagen, was Selbstbewußtsein ist und wie man es bekommen kann; Sie haben es vielleicht sogar selbst?«
»Selbstbewußtsein? Man ist sich nicht ganz klar darüber, ob ich es habe; sollte ich es aber haben, so würde ich es Ihnen gern zur Verfügung stellen, falls Sie nicht etwa mein Fell damit meinen. Fragen Sie indes doch meinen Freund, den Eskimo.«
»Der Herr Seehund meint den Menschen«, erklärte der Geysir. »Aber warum wollen Sie ihn nicht selbst fragen?«
»Ja, sehen Sie, unser Verkehr – nun natürlich, wir verkehren miteinander, das versteht sich von selbst –, aber der Verkehr ist etwas einseitig, wir verstehen uns nicht immer. Natürlich nur eine kleine Verschnupfung, bei diesem Klima erklärlich.«
»Und worin besteht Ihr Verkehr, wenn ich fragen darf?«
»Er sticht nach mir mit seinem Spieße, und meine Familie liefert ihm dafür den Tran. Grüßen Sie ihn nur von mir.«
Damit schlüpfte der Seehund ins Wasser.
Der Erdgeist begab sich nun zum Eskimo, und der Geysir fragte diesen, was Selbstbewußtsein wäre. Der Eskimo meinte, davon wüßte er nichts. Aber der Geysir setzte ihm auseinander, daß er es ganz bestimmt besäße, denn er sei ja ein Mensch; und das Selbstbewußtsein sei eben das, was den Menschen auszeichne, und es sei das Beste an ihm.
Da lachte der Eskimo und meinte, das hätte er ihm nur gleich sagen sollen; wenn es das Beste an ihm sei, so wolle er es ihm gern zeigen; er meine jedenfalls seinen Tranvorrat. Aber geben könne er ihm nichts davon. Wenn er indessen seine Frau mitnehmen wolle, so könnten sie sich eher einigen.
Der Erdgeist sah ein, daß er hier nicht an den Rechten gekommen war, und beschloß, die Menschen aufzusuchen, welche Bohrlöcher machen und Abhandlungen schreiben. Er reiste also nach Süden. Der Geysir jedoch blieb zurück; er erklärte, es werde ihm dort zu warm, und außerdem würde ihm sein Freund, der Seehund, das übelnehmen.
Kaum war der Erdgeist nach Deutschland gekommen, als er alle Leute, die ihm begegneten, fragte, was Selbstbewußtsein sei und wie man es bekomme. Sie schüttelten aber den Kopf und verstanden nicht, was er meinte.
Endlich sagte ihm einer: »Selbstbewußsein? Das ist nämlich, wenn man sich was einbildet. So was können Sie bei uns überall finden. Gehen Sie man ruhig nach Berlin, das kenn' ich, weil ich dort gedient habe, und fragen Sie da, wo die eingebildetsten Leute sind.«
Sofort reiste der Erdgeist nach Berlin und fragte den Portier in seinem Hotel, wo die eingebildetsten Leute seien.
Der Portier konnte sich natürlich nicht denken, daß jemand die eingebildetsten Leute suche; er glaubte sich verhört zu haben, jedenfalls sei er nach den feingebildetsten Leuten gefragt worden. Daher sagte er:
»Die feingebildetsten Leute, mein Herr, sind die Herren Oberkellner der großen Hotels. Sie sprechen sämtliche Sprachen, machen die feinsten Verbeugungen und haben die neuesten Fräcke. Die gebildetsten Leute sind nächstdem die Herren Redakteure und Journalisten. Sie wissen alles und müssen auch alles wissen, und wenn sie etwas nicht wissen, so brauchen Sie sich bloß hinzusetzen, um darüber zu schreiben, alsdann weiß es jedenfalls bald das Publikum. Recht gebildete Leute findet man übrigens auch zuweilen unter den Herren Geheimräten, Professoren, Kommerzienräten und geborenen Baronen.«
Der Erdgeist staunte über diese ungeheure Menge von Leuten, welche, wie er meinte, sich über den Begriff des Selbstbewußtseins klar seien. Sein Respekt vor dem Menschengeschlecht stieg, seine Begierde nach dem Selbstbewußtsein wurde noch heftiger.
Er ging zunächst zu dem Oberkellner und fragte ihn, was Selbstbewußtsein sei.
Der Oberkellner sah ihn von oben bis unten an, und da er ihm etwas schäbig vorkam, so näselte er: »Selbstbewußtsein ist, wenn man nicht unter fünf Mark Trinkgeld nimmt.«
»Können Sie mir nicht etwas davon ablassen?« fragte der Erdgeist.
»Nun, weil Sie es sind«, sagte der Oberkellner, »so will ich ausnahmsweise auch vier Mark annehmen.«
Da aber der Erdgeist keine Miene machte, in die Tasche zu greifen, so begleitete ihn der Oberkellner an die Tür.
Der Erdgeist ging auf das nächste Redaktionsbüro. Der Redakteur für das Feuilleton schwitzte gerade über seiner Sonntagsplauderei. Als er die seltsame Erscheinung des Erdgeistes sah, hoffte er auf einen interessanten Stoff und empfing ihn sehr höflich.
Gleich bei der stereotypen Frage des Erdgeistes erkannte der Redakteur, daß er es mit einem Original zu tun habe, glaubte aber, der Erdgeist wolle ihm einen Artikel anbieten. Er sagte daher:
»Selbstbewußtsein, mein Herr, ist ein philosophischer Begriff. Man hat darüber verschiedene Theorien, welche Sie im Konversationslexikon angedeutet finden. Sie müssen wissen, daß ich mich außerordentlich für Philosophie interessiere, ich beschäftige mich selbst damit in meinen Mußestunden. Aber schreiben Sie um Himmels willen nicht darüber! Ich zwar, für meine Person, würde Ihren Artikel mit Vergnügen lesen. Jedoch das Publikum! Ich bitte Sie, wie können wir unserem Publikum so etwas bieten! Die Zeitung verlöre sämtliche Abonnenten. Nur nichts Philosophisches! Das Publikum mag davon nichts wissen. Nur nichts, was ernste Aufmerksamkeit erfordert. Höchstens noch ein paar Gespenstergeschichten, wie sie Mirax erzählt; aber mit ein paar Skataufgaben wäre mir besser gedient.«
Da der Erdgeist sah, daß er auch hier nicht zu seinem Ziele kommen würde, so verabschiedete er sich und beschloß, sich nunmehr an die Herren Geheimräte zu wenden. Aber wie viele er auch fragte, über das Selbstbewußtsein konnte er keine Auskunft erlangen.
Ein Geheimer Medizinalrat hörte ihn aufmerksam an, befühlte seinen Kopf, sah ihm in die Augen und ließ sich die Zunge herausstrecken. Dann sagte er:
»Das Selbstbewußtsein beruht vermutlich auf der Tätigkeit der Großhirnrinde. Es scheint, daß Sie kein normal entwickeltes Großhirn besitzen. Wenn es Ihnen gelänge, durch sorgfältige Kopfmassage die Hirntätigkeit zu stärken, so wäre es möglich, daß Ihre geistige Organisation sich vervollkommnete. Auf jeden Fall sind Sie von meinen Kollegen falsch behandelt worden; sie verstehen sämtlich nichts. Im übrigen rate ich Ihnen zu dem von mir empfohlenen Kraftleguminosen-Extrakt. Mit den philosophischen Begriffen aber quälen Sie sich nicht weiter ab; das ist alles dummes Zeug. Was uns nicht in den Organen wächst, das kann uns auch nichts helfen. Die Konsultation kostet fünfzig Mark, die mein Diener in Empfang nimmt. Adieu!«
Endlich trat der Geist in das Kontor eines Kommerzienrates. Das war ein leutseliger Herr, der ihn zum Frühstück einlud, als er merkte, daß er ihn nicht anpumpen wollte. Als sie ein paar Gläschen Wein getrunken hatten, klopfte er ihm auf die Schulter und sagte:
»Lieber Herr, sehen Sie, ich bin ein Mann mit allgemeinen Interessen, ein Mann, der ein Herz hat für sein Volk und sein Vaterland, und ich bin ein praktischer Mann. Man weiß das, und man wendet sich an mich. Ich gebe immer, wo es heißt, für Kunst und Wissenschaft etwas zu tun. Entrieren Sie ein wissenschaftliches Unternehmen, das Geld kostet, es soll an mir nicht fehlen. Veranstalten Sie eine Polarexpedition, eine Tiefbohrung, einen Explosionsversuch – aber mit Selbstbewußtsein und Bewußtsein und dem philosophischen Zeug bleiben Sie mir vom Leibe! Ich habe noch nie gehört, daß man für die Philosophie Geld verlangt oder ausgegeben hätte, folglich kann sie auch nichts wert sein. Ich versichere Sie – und Sie können mir das glauben, weil ich mitten im Leben stehe und die Welt kenne –: Kein Mensch mag heutzutage von Philosophie etwas wissen.«
»Aber ich habe doch gelesen«, bemerkte der Erdgeist schüchtern, der durch seinen Umgang mit Menschen schon einigermaßen gebildet geworden war und sich jetzt an einige Sätze aus der Abhandlung von Mirax erinnerte, »das eigentliche Wesen der Welt ist der Geist, und wer sich auf eine höhere Stufe des Geistes erheben könnte, der würde dadurch den Weltprozeß selbst wesentlich fördern.«
»Ob Sie den Weltprozeß damit fördern«, erwiderte der Kommerzienrat, »das verstehe ich nicht; aber ich rate Ihnen, fördern Sie lieber Steinkohlen oder Strontianit, das wird Sie selbst mehr fördern. Ich habe da einen Neffen, der hat Philosophie studiert und schreibt den ganzen Tag, aber ich glaube nicht, daß ihm jemand etwas für seine Bücher gibt.«
»Ein Philosoph, der Bücher schreibt?« rief der Erdgeist in der frohen Erwartung, endlich sein Ziel gefunden zu haben. »Das ist vielleicht Heino Mirax?«
»Oh! Mirax? Der berühmte Mirax? Ja, wenn er der wäre! Der versteht es! Sehen Sie, der Mann macht Geld, der schreibt in allen unseren großen Revuen, und seine Bücher haben viele Auflagen. Das lasse ich mir gefallen! Aber mein Neffe meint, das sei überhaupt keine Philosophie, sondern Schwindel! Nun, sehen Sie,im Vertrauen gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich lese Mirax, weil es Mode ist, und man kann sich etwas dabei denken. Es kitzelt uns. Der Mann enthüllt die tiefsten Geheimnisse der Welt, wie unsereiner sein Pult aufschließt; es macht ihm gar keine Mühe. Was geht es mich an, ob er dabei flunkert? Das ist nicht mein Fach; wenn er eine Anleihe aufnehmen will, werde ich ihn mir näher ansehen. Aber seine Bücher lese ich wie einen Roman; da freut es unsereinen, wenn man so schön sieht, wie sich der Geist entwickelt und wie der Mensch später aussehen und speisen wird und wie es unserer verstorbenen Urgroßmutter geht.«
»So sehen Sie doch, daß das Publikum an der Philosophie Anteil nimmt.«
»Ja, wenn Sie es meinen – aber es ist doch eigentlich nur des Spaßes halber; ich glaube nicht, daß sich einer im Ernste darauf verläßt. Man macht es eben mit, bis wieder einmal ein anderer kommt. Und dann, wie gesagt, mein Neffe hält nichts davon, und ich dachte, Sie meinten mit Philosophie die Beschäftigung meines Neffen. Und das, was dieser treibt, soviel kann ich Sie versichern, das versteht einer nicht so leicht. Aber wenn Sie es einmal versuchen wollen – dort drüben wohnt er.«
Der Erdgeist ging zu dem Philosophen. Auf dem Wege dachte er, daß es doch eine bedenkliche Geschichte sein müsse mit dem Selbstbewußtsein, wenn die Menschen sich so wenig darum kümmerten und nichts damit anzufangen wüßten. Und die Philosophie! Die eine Art wurde nicht respektiert, weil sie bloß zur Befriedigung der Neugier dient, und die andere Art mochte überhaupt niemand näher ansehen. Sollte er nicht lieber ohne Selbstbewußtsein bleiben? Aber nun wollte er doch wenigstens noch einen Versuch machen.
Er war ungeduldig und ärgerlich geworden, und als er bei dem Philosophen eintrat, donnerte er ein wenig mit der Tür und rief ihn in seiner Erdgeistmanier an: »Wie gelange ich zum Selbstbewußtsein?«
Der Philosoph sah ihn bedächtig an und sagte: »Wollen Sie nicht erst eine Zigarre nehmen? Bitte, hier. Und nun, womit kann ich dienen?«
»Ich bin der Erdgeist Lithosphäros«, sprach der Geist etwas besänftigter, »und möchte wissen, was Selbstbewußtsein ist und wie man dazu gelangt.«
Der Philosoph lächelte ein wenig und sagte, indem er sich selbst eine Zigarre anzündete: »Das Selbstbewußtsein ist die synthetische Einheit der Apperzeption, durch welche das Ich aus dem Zustande des lediglich subjektiven Erlebnisses heraustritt, indem es sich seinem Bewußtseinsinhalte als dem ihm gegebenen Objekte gegenübersetzt. Das selbstbewußte Bewußtsein unterscheidet sich von der bloßen Bewußtheit dadurch, daß es ein Verhältnis zu seinem Erlebnis besitzt. Somit wissen Sie, was das Selbstbewußtsein ist. Aber wie man dazu gelangen kann, wenn man es nicht besitzt, das ist eine Frage, die niemand beantworten kann, weil sie über die Grenzen der Erfahrung hinausgeht. Wir können nur analysieren, was in unserem Bewußtsein gegeben ist; wie es hineinkommt, das ist eine unzulässige Frage, und sie zu diskutieren ist unwissenschaftlich.«
Mit diesen Worten wandte sich der Philosoph wieder zu seinen Büchern.
Der Erdgeist stand sehr niedergeschlagen da und sagte: »Lieber Herr Philosoph, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe noch nicht recht verstanden, was Sie meinen. Könnten Sie mir die Sache nicht etwas populärer darstellen?«
»Nein«, entgegnete der Philosoph kurz, »das kann ich nicht; das wäre unter meiner Würde und würde mich als Gelehrten diskreditieren.«
»Aber gibt es denn wirklich keinen Weg, zum Selbstbewußtsein zu gelangen?«
»Ich sage Ihnen ja, daß man hier nichts wissen kann. Der menschliche Verstand reicht nicht über seine Grenzen; wer Ihnen mehr verspricht, der phantasiert. Wenn Sie aber kein Selbstbewußtsein haben, so seien Sie froh, alsdann kann Sie die ganze Frage nichts kümmern. Die Rätsel des Daseins beginnen erst mit dem Augenblicke, da Sie sich als Ich gegenüber der Welt erkennen; bleiben Sie in dem glücklichen Zustande, in welchem es nichts gibt als das unbesorgte Spiel Ihres eigenen Gemüts!«
»Aber Herr Mirax hat doch geschrieben –«
»Herr Mirax?« rief der Philosoph und lachte laut. »Ja, wenn Sie Mirax gelesen haben, der weiß es freilich; der konstruiert Ihnen die Welt auf Bestellung und sieht überall Geister; der wird Ihnen auch sagen können, wie Sie zum Selbstbewußtsein kommen. Aber da müssen Sie sich schon zu ihm selbst bemühen. Ich empfehle mich Ihnen.«
Und so fragte sich denn der Erdgeist glücklich bis zu Heino Mirax hindurch. Da er ihm imponieren wollte, so erschien er ihm in seiner natürlichen Gestalt, wie er im Erdrindenkasino zu kegeln pflegte. Aber Mirax war an Geistererscheinungen gewöhnt, und so erregte Lithosphäros bei ihm wenig Schrecken. Als der Erdgeist seinen Namen nannte, flog ein stolzes Lächeln über Mirax' Züge. Sein großer Plan war gelungen, er hatte den Erdgeist beschworen, und jetzt sollte die Erziehung des Elementargeistes zum Vernunftwesen beginnen!
Nachdem Mirax dem Erdgeiste nochmals kurz die Grundzüge des Mystotranszendentalismus gepredigt hatte, ermahnte er ihn eindringlich, sich nunmehr um das Selbstbewußtsein zu bemühen, indem er ein Verhältnis zu sich selbst zu gewinnen strebe.
»Wenn Sie erst begreifen«, sagte er, »daß Ihr ganzes Leben von Ihnen selbst erlebt wird; wenn Sie merken, daß Sie selbst etwas anderes sind als das, was Ihnen begegnet; wenn Sie sich als Zuschauer Ihres eigenen Seins fühlen – dann haben Sie Selbstbewußtsein. Suchen Sie den Gegensatz von Ich und Welt zu erzwingen.«
»Und was kann ich dazu tun?« fragte der Erdgeist etwas enttäuscht.
»Setzen Sie sich als Subjekt einem Objekt gegenüber. Haben Sie sich schon einmal verliebt?«
»Nein«, sagte der Erdgeist beschämt.
»Nun, so versuchen Sie es«, ermunterte ihn Mirax. »Wenn Sie etwas finden, von dem Sie fühlen, daß es zu Ihnen gehört, während es Ihnen doch nicht erreichbar ist, so hat die Spaltung des Bewußtseins begonnen. Dann werden Sie bald die Erscheinung der Erdoberfläche als Ihr äußeres Gewand erkennen, und Sie werden durch den Fortschritt Ihres Geistes imstande sein, die Natur zu ungeahnter Vervollkommnung zu bringen. Sie werden dann zum Beispiel einsehen, daß es gut wäre, den Magen der Menschen zum Verdauen unmittelbar mineralischer Nahrung einzurichten, um uns den Sonnenbewohnern zu nähern; oder Sie könnten den Isthmus von Panama durchbrechen oder sonst eine Kulturaufgabe lösen. Derartige Leistungen erwarte ich von Ihnen, sobald Sie aus Ihrem elementaren Traumleben in das Reich der selbstbewußten Geister getreten sind. Nun versuchen Sie Ihr Heil, und geben Sie mir bald wieder Nachricht, damit ich einen Artikel über Sie schreiben kann.«
»Wie?« rief der Erdgeist unwillig. »Nur darum soll ich das Selbstbewußtsein erwerben, damit ich mich in den Dienst eurer Kultur stelle? Damit ich eure Arbeit auf meine Schultern nehme? Oder damit Sie einen Artikel schreiben können? Das will ich mir doch noch überlegen!«
Mit diesen Worten stampfte er auf den Boden, der ihn verschlang, während eine furchtbare Schwefelwasserstoffexhalation Heino Mirax' Studierzimmer erfüllte.
Mit den Menschen freilich wollte der Erdgeist nun nichts mehr zu tun haben, nachdem er erkannt hatte, wie es um sie stand. Um das höchste ihrer Güter, das Selbstbewußtsein, kümmerten sie sich nicht; und ihm wollten sie nur davon mitteilen, um sich selbst das Leben zu erleichtern. Aber der Gedanke, ob er nicht zum Selbstbewußtsein gelangen könne, ließ ihm doch keine Ruhe; er konnte ja dann immer noch tun und lassen, was er wollte. So suchte er nach einem Objekt, dem er sich gegenübersetzen könne.
Sobald er etwas bemerkte, was ihm gefiel, machte er sogleich den Versuch, ob es ihm erreichbar sei. Der Geysir besaß eine schöne Tabakspfeife, denn er rauchte noch immer stark; aber kaum hatte der Erdgeist den Wunsch danach ausgesprochen, so wurde sie ihm schon dediziert. Und so ging es ihm mit allem. Es gab wohl vielerlei, was er nicht erlangen konnte, so zum Beispiel das Selbstbewußtsein; aber er fühlte nicht, daß diese Dinge zu ihm gehörten, und so nützten sie ihm nichts zur Spaltung des Bewußtseins. Was aber zu ihm gehörte, die eisigen Spitzen des Himalaja und die Glutbäche des Erdinnern, das gehorchte seiner Gewalt, und die Spiele seiner Geisterlaune waren die Gesetze der Natur.
Eines Tages ging er höchst verdrießlich auf Grönland spazieren, wo er eben den Seehund besucht hatte. Da sah er lichte Strahlen emporzucken, in bunten Feuern erglänzte das Firmament, ein herrliches Nordlicht enthüllte seine Pracht den staunenden Blicken des Erdgeistes. Er fühlte, daß diese Erscheinung zu ihm, zu seinem Erdleben gehöre, und er wünschte die Strahlenkrone auf sein Haupt zu setzen. Doch wie er die Hand danach ausstreckte, wich sie zurück; von ihm fort flohen die Nordlichtgluten, vergebens befahl und drohte, vergebens bat er und flehte – unerreichbar in der Höhe des äußersten Luftkreises, unerreichbar dem schwerfälligen Geiste der Erdrinde flatterte die flüchtige Lichtgestalt einher. Da erfüllte unendliche Sehnsucht sein Herz, und zum ersten Male rief er die Zauberformel: »Ich bin dein!«
Der Erdgeist hatte sich in das Nordlicht verliebt. Wie es nicht anders sein konnte, erfüllte sich die Vorhersagung des Miraxianismus. Die Spaltung seines Bewußtseins war in demselben Augenblick vollzogen; weit klafften die beiden Hälften als Ich und Du auseinander. Ein seltsamer Schimmer erhellte sein Gemüt.
Von den Polen zuckten die Nordlichtstrahlen in das Erdinnere; das Dunkel wich zurück, und klar erleuchtet sah Lithosphäros plötzlich rings um sich eine Welt. Wie verändert war alles auf einmal! Er sah den Wirbeltanz der Welten im All, sah die Sonnen in ihren Bahnen gehen und erkannte die großen Fügungen, die das Universum zusammenhalten. Aber nun erkannte er auch sich selbst und fand, daß er gar nicht mehr der Erdgeist war, dem es auf seiner Kegelbahn so wohl behagt hatte. Poseidon und Hephäst schienen ihm alte Märchen, die er selbst gedichtet, und der Geysir und der Gletscher waren tote Trümmerhaufen, über die er beim Spazierengehen stolperte; denn die Erde war jetzt für ihn ein äußerer Gegenstand. Und zu seinem Schrecken sah er sich an die Sonne gefesselt, zu ihr gezogen, um sie geschwungen, und er begriff, daß es mit all der Pracht einmal ein Ende haben müsse.
Da blickte er wieder auf das Nordlicht, das schwebte jetzt in all seinem Liebreiz zu ihm herab und umschlang ihn mit seinen Strahlenarmen. Er fühlte, wie seine Elementargewalt ihm verlorenging, und wußte nicht, ob das am Selbstbewußtsein läge oder vielleicht daran, daß er verheiratet war. Und er wollte noch klarer blicken, durch die leuchtenden Bande und Fesseln des Nordrots hindurch, bis ans Ende der Welt. Dort im Grunde der Dinge sah er ein Riesenweib sitzen, das fing Sonnen mit ihren Händen und warf sie in den Raum, daß sie sprühend verzischten.
Das ist gewiß das Objekt, dachte er, ich will mich ihm gegenübersetzen.
Da sprach das Weib: »Was willst du, Erdgeist? Ich bin die Endlichkeit; und wer mich schaut, dem springt das Weltleid aus dem Haupte. Hebe dich fort von mir!«
Er aber warf sich ihr zu Füßen und rief: »Sei mein Objekt, laß mich dein Subjekt sein.«
Da zuckte es gewaltig um ihn rechts und links, daß sein Kopf in loderndem Feuer stand; starke elektrische Schläge durchschütterten ihn, und das Nordlicht rief: »Was fällt dir ein, vorwitziger Erdgeist? Mir hast du Liebe geschworen und willst dich hier zu diesem Objekt als Subjekt setzen? Ich bin dein Objekt, und du, armseliges Subjekt, gehörst zu mir. Jetzt hast du Selbstbewußtsein, bist verantwortlich für dein Ich und gebunden an dein Du! Je höher im Geisterreiche man steigt, um so enger sind die Fesseln, die uns halten; wer ein Objekt hat, dem ist die Freiheit des Subjekts verloren. Gleich mache dich an die Arbeit und grabe einen ordentlichen Kanal durch das Polareis, damit die Menschen ihre nächste Sommerfrische am Nordpol zubringen können.«
Da empörte sich im Erdgeist das alte Titanenblut der Elemente. Wild donnerte er gegen den Nordpol, daß der gesamte Erdmagnetismus außer Rand und Band geriet und das Nordlicht furchtsam in den Weltraum floh, wo es schon längst mit einem Kometen kokettiert hatte. Lithosphäros aber verfluchte das Selbstbewußtsein und alle Objekte und erschien mit glühendem Haupte im Studierzimmer des Heino Mirax.
»Unseliger«, donnerte er ihn an, »wie konntest du es wagen, die Kräfte der Natur mit deinem naseweisen Rate zu stören? Beleuchte mit dem Lämpchen deiner Vernunft die Irrwege deines Eintagsgeschlechtes; spiegle ihm vor, daß deine Phantasien reale Mächte seien, welche die Welt regieren, und dichte deine Puppenspiele für die großen Kinder, die daran glauben. Aber versuche nie wieder die Geister zu berufen, die nichts wissen wollen von euren Sorgen und Mühen! Ich werde mich hüten, den Weltprozeß zu Ende zu denken; dafür magst du hübsch allein sorgen!«
Wieder erschütterte ein Erdbeben das Haus, und der Erdgeist fuhr hinab ins Erdrindenkasino, wo er sich bald mit seinen Freunden zum gemütlichen Kegelspiel gesellte. Mirax aber fiel in eine Betäubung.
Als Mirax aus seiner Ohnmacht erwachte, sah er zu seinem Vergnügen, daß das Erdbeben weiter keinen Schaden in seinem Zimmer angerichtet hatte. Nur die beiden Büsten Kants und Goethes waren von ihren Postamenten gestürzt, und auf seinem eigenen Haupte fand er die beiden Kränze vereint, die jene getragen hatten. Dies war ein schöner Beweis für die Existenz und Zurechnungsfähigkeit des Erdgeistes.
Mirax beeilte sich, einen Artikel über sein psychisches Experiment mit dem Erdgeiste zu schreiben. Diese Abhandlung machte ungeheures Aufsehen und begründete den Miraxianismus felsenfest. Denn wenn man auch zugeben mußte, daß der Versuch, dem Erdgeiste das Selbstbewußtsein zu verschaffen und dadurch die Natur mit einem Schlage zu einer höheren Daseinsstufe zu führen, nur teilweise gelungen war, so konnte man doch von einem ersten Versuche nicht mehr erwarten. Nur Unverstand oder Mißgunst können glauben, daß die Elementargeister sofort den ganzen Wert der ihnen verliehenen Gabe begreifen würden; auch sie werden erst zum Selbstbewußtsein erzogen werden müssen, und man muß auf andere Wege denken, um ihnen das Selbstbewußtsein vorsichtiger beizubringen und die Weltseele nach und nach zu züchten. Die Möglichkeit dieser direkten Einwirkung auf die Natur durch die pädagogische Behandlung der Elementargeister aber ist durch Mirax und sein Experiment mit dem Erdgeist ein für allemal bewiesen. Künftighin wird man sich nicht auf den Verkehr mit den Geistern verstorbener Menschen beschränken, sondern man wird die Geister der Natur berufen und leiten. An Stelle endloser Experimente mit den toten Stoffen des Laboratoriums oder grausamer Vivisektionen wird die Interpellation der Weltseele und die Unterhaltung mit den Geistern der Erde, des Wassers und der Luft treten. Gegenüber dem Ausblicke in diese herrliche Errungenschaft des Miraxianismus kann es nur kleinlich und albern erscheinen, wenn boshafte Gegner das Erlebnis mit dem Erdgeiste für einen bloßen Traum erklären wollen, den Heino Mirax während eines nervösen Anfalls gehabt habe. Derartige Insinuationen richten sich selbst.
Wenn nicht schon die innere Wahrscheinlichkeit der Lehre und die unzweifelhafte Ehrlichkeit eines Mirax Beweis genug wären, so fehlte es auch nicht an einem sinnlichen Zeichen für den Besuch des Erdgeistes. Mit den Büsten Kants und Goethes war zugleich ein Buch aus Mirax' Bibliothek herabgestürzt, nämlich Kants »Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik«, und es war folgender Satz dieses Buches vom Erdgeist stark und deutlich angestrichen:
»Die anschauende Kenntnis der anderen Welt kann allhier nur erlangt werden, indem man etwas von demjenigen Verstande einbüßt, welchen man für die gegenwärtige nötig hat.«
Die Gegner des Miraxianismus, welche leugnen, daß es eine Geisterwelt hinter der Natur gebe und daß dem Menschen die Erkenntnis dieser Geisterwelt möglich sei, diese kurzsichtigen Anhänger eines blöden Sinnlichkeitsphantoms, sie mögen sich die Mahnung des Erdgeistes zu Herzen nehmen, die er ihnen durch den Mund des von ihnen so vergötterten Kant gab! Es ist wahrlich Zeit, daß sie etwas von demjenigen Verstande einbüßen, mit welchem sie sich brüsten, Wissenschaft von der Natur zu errichten; es ist Zeit, daß sie wieder in den Zustand kindlicher Ahnung einer Geisterwelt zurückkehren, in welchem sie mit uns rufen:
»Es lebe Heino Mirax, der Umkehrer der Wissenschaft!«
Wo die Halde sich senkt am Bergeshang, rieselt ein Quell im feuchten Wiesengrund, ehe er sich schäumend in die dunkle Waldschlucht stürzt. An seinem Laufe zog der Morgennebel in die Höhe. Die weißen Streifen wehten über die hohen Gräser hin, zwischen denen der Quell sich verbarg. Mit ihren schlanken Ähren hatten sie die Nacht hindurch nach den Sternen am klaren Himmel geschaut, aber die Sterne hatten sich nicht gerührt, und so waren die Gräser kalt geworden, eisig kalt, und anders verdienten's die Sterne auch garnicht.
»Das ist die richtige Temperatur,« sagte der Nebel, als er über die Halme strich. »Man muß sich konzentrieren, ehe die Sonne kommt.« Und da hing ein Tröpfchen an jedem Halme.
Die Sonne kam und die Tröpfchen glänzten in bunten Farben, aber sie wurden immer kleiner, zuletzt waren sie völlig verschwunden, und sie wußten nichts von der ganzen Geschichte. Die andern Tropfen aber, die im Schatten hingen, meinten, es sei ihnen recht geschehen, und das hätten sie nun von der Sonne; aber jetzt sind wir an der Reihe, und nun wollen wir uns breit machen.
Da kam der Wind und schüttelte die Gräser, und die ganze Gesellschaft stob umher. Die einen fielen auf den Boden und zerflossen, die andern in die Sonne und wurden aufgesogen, und sie hatten auch keine Geschichte.
Einer aber, gerade dort, wo der Bach den Winkel macht und unter den großen Blättern des Huflattigs verschwindet, hatte sich festgeklammert und blieb sitzen. Ein Käfer kroch vorbei und stieß ihn mit einem Beine an, da gab's eine kleine Schwingung im Tropfen, er wurde platt und dann wieder rund, und so merkte er, daß er etwas wäre. Es dünkte ihm, als könne er zusammenhalten und etwas erleben. Aber hier unter den dichten Blättern vermochte er nichts zu sehen, und wie der Wind wieder über die Halde zog, ließ er den Stengel fahren und sprang hinein in den Bach. Schnell ging's dahin, in's Dunkel hinein, durch's Tannendickicht. Wohlig war ihm zu Mute, als er in der volleren Flut dahinschoß, er wußte nur nicht recht, ob er selber es sei, was dort plätscherte. Aber jedesmal, wenn das Wasser auf einen Stein schlug und wieder in Tropfen zersplitterte, und er seine Gestalt zurückerhielt, da ward's ihm gar seltsam, bang und verlassen, als würd' er hinausgedrängt in's Weite, in's Unbekannte. Und es kam eine Angst über ihn, was er da draußen wohl solle. Warum nicht immer am Grashalm hängen und sich mit ihm im Winde neigen? Gab's denn überhaupt etwas dort hinter dem Walde?
Auf einmal wurde es hell um ihn am Waldesrand, die Steine funkelten wieder im Sonnenschein, und der Bach machte einen kühnen Sprung darüber. Beim letzten Abprall fühlte sich der Tropfen neu gerundet und schnell entschlossen sprang er zur Seite, bekam glücklich ein Farnkraut zu fassen und barg sich im kühlen Schatten eines großen Felsblocks. Den Stein umspannten die Wurzeln einer alten Fichte, die hier als Waldwärter in die Lüfte ragte.
»Das war Dein Glück, Tröpfchen,« sagte das Farnkraut. »Du kommst hier in eine sehr gebildete Gesellschaft.«
»Glück? Dummes Zeug!« brummte der Felsblock. »Die Bildung macht's nicht, und wenn ich nicht hier wäre, thätest Du besser, Dein Glück wo anders zu suchen.«
»Sie haben überhaupt keine Bildung,« sagte die Fichte. »Darin eben liegt's, daß Sie mich nicht verstehen. Sie sind nur eine rohe, ungestaltete Masse, ein gewöhnlicher Kalkstein; Sie sind nicht einmal krystallinisch, und das könnte man doch von Ihnen verlangen. Hätte ich das vor hundert Jahren gewußt, so hätte ich Ihnen niemals meine Wurzel gereicht.«
»Man merkt es, daß Sie alt geworden sind,« erwiderte der Stein.
»Das ist eben das Schöne an der Bildung, daß sie fortschreitet. Ich habe Figur, ich habe Wurzeln und Stamm und Nadeln, ich habe Tüpfelzellen und einen Kreislauf, ich atme Kohlensäure und ich erzeuge sogar Chlorophyll, und das kann nicht einmal der Mensch.«
»Und wenn ich Sie unten nicht hielte, wären Sie längst umgestürzt. Bei jedem Stürmchen biegen Sie sich, daß ich's hier deutlich fühle. Was nützt Ihnen da Ihre Bildung? Sie haben eben keinen Charakter, und Charakter ist die Hauptsache, und den habe ich. Wie ich hier liege, so liege ich schon viele hundert Fichtenalter, und so werde ich liegen bleiben.«
»Und darin finden Sie Ihr Glück?«
»Habe ich garnicht nötig.«
»Wenn Sie aber der Mensch einmal in die Luft sprengt?«
»Sorgen Sie nicht, der wird Sie schon vorher fällen.«
Tröpfchen zitterte am Farnkraut, als es das hörte. Was mußte der Mensch für ein Wesen sein, daß er Bäume fällen und Felsen sprengen konnte. Und es wandte sich schüchtern an das Farnkraut und fragte:
»Was ist der Mensch?«
Das Farnkraut fühlte sich geschmeichelt; denn Fels und Fichte fragten es niemals um seine Meinung.
»Der Mensch,« sagte das Farnkraut herablassend, »ist ein ausländisches Eichhörnchen, welches Papier, Eierschalen und Wurstpellen produziert, um dieselben von Zeit zu Zeit bei uns niederzulegen. Übrigens rate ich Dir, weniger zu sprechen; Dein Vater der Bach, macht ohnehin den größten Lärm in der Gegend.«
Tröpfchen wagte nicht weiter zu fragen. Aber nun lauschte es sorgfältig. Denn vom Thale herauf ließen ich Schritte vernehmen, Stimmen erklangen auf dem Wege.
Zwei Wanderer traten in den Schatten der Fichte. Der Vorangehende, ein hagerer Herr mit dunklem Vollbart, drehte sich um und sagte:
»Nun werden Sie zufrieden sein, dies ist der übliche Frühstückspunkt.«
Der zweite kam etwas keuchend nach. Er trug den Hut in der Hand. Sein volles Gesicht glänzte in Schweiß gebadet und gerötet unter dem hellblonden Haar, das so kurz geschoren war, als käme er eben aus dem Zuchthause. Er kam aber aus einem Friseurladen der Stadt. Auf den Zuruf des andern blieb er stehen, setzte den Hut auf den Kopf, den Kneifer auf die Nase, strich seinen kleinen Schnurrbart, warf einen Blick auf den moosbedeckten Felsblock und fragte mißtrauisch:
»Ameisen?«
»Keine Sorge,« sagte der erste, das gemeinsame Frühstück auspackend.
Der Blonde rückte sich auf dem Stein zurecht, setzte seinen Kneifer nochmals fest und sah dann hinaus in die sonnenbeglänzte Landschaft.
»Schneidiger Punkt,« sagte er.
»Meistens Kalk,« bemerkte der Schwarze, mit seinem Stock an den Felsen klopfend. »Drüben bunte Sandsteine, dort vorn Keupermergel — alles zusammengestürztes Gelände. Kein rechtes System, keine Kammbildung, in meinen Augen gar kein Gebirge.«
»Unsinn! Sie haben kein Gefühl für Naturschönheit,« erwiderte der Blonde und warf eine Eierschale so dicht an dem Farnkraut vorüber, daß Tröpfchen vor Schreck bald ins Wasser gefallen wäre. »System ist Unsinn. Naturgefühl, das macht es. Bin kolossal für Naturgefühl. Einziges Erziehungsmittel des Volkes. Muß sein Glück suchen in Bewunderung. Sehen Sie dahin, jener Bergrücken, ganz Moltkesche Nase! Welterobernde Ruhe blickt schweigend in das All, in das blaue Himmelsauge, Sinnbild der deutschen Frau — denn wo das Strenge mit dem Zarten — deutsche Kraft und deutsches Gemüt drücken der Weltentwickelung den Stempel auf. Niederdeutsche Ebene und Mittelgebirge — Empfindung und Charakter — Matthisson kränzt Luther auf der Wartburg; das ist die beste Wacht am Rhein. Führt unsere Jugend herauf und zeigt ihr die Welt, wie sie ist, wie die charaktervolle Zerklüftung der Natur in der Einheit des Gefühls zerschmilzt, und ihr habt das Ideal der deutschen Tugend, die Treue. Denn weil nur deutsches Klima derartig zerrissenes Gelände in den weichen Gemütsmantel schattenden Bergwalds zu betten vermag, darum eben erweist sich deutsche Treue als die schützende Hülle unseres universellen Geistes. Geben Sie mir etwas Salz.«
»Alles Einbruch,« sage ich Ihnen, »ausgewaschene Gipsnester.«
»Was wollen Sie damit dem Volke bieten? Geben Sie ihm Gefühl, Naturgenuß, Auflösung in Bewunderung als Ersatz für die volkswirtschaftlich notwendige Entsagung. Lassen Sie mir noch einen Schluck Rotwein.«
»Warum begnügen Sie sich nicht mit dem Naturgenuß?«
»Das ist etwas anderes. Nur die Ungleichheit ist kulturfördernd. Sehen Sie nicht, wie aus dem Einsturz drüben die mächtige Kuppe mit den drei Tannen hervorragt? Das ist Bismarcks Stirn! Die Elektrizität, die Weltkraft des Jahrhunderts, warum verteilt sie sich gleichmäßig auf der Kugel und strömt aus der Spitze aus? Passivität des Abgeflachten, Aktivität des Schneidigen, das sind die deutschen Grundkräfte, das lassen Sie uns aus der Natur lernen. Diese Landschaft hat ein durchaus germanisches Gepräge. Wie die Seele den Körper, baut sich der Geist die Natur, der Mensch das Gelände. Nur ein gläubiges Volk, dieser knorrigen Landschaft entsprossen, konnte das Pulver erfinden! Ist dieses Ei das letzte?«
»Sie sind in einem kleinen Irrtum, Verehrter. Hier zu unserer Rechten, über diesen Rücken läuft die Sprachgrenze. Alles, was Sie dort drüben beschrieben haben, ist nicht mehr deutsch. Sehen Sie die Karte.«
»Ach was, Karte! Bringen Sie kein Blatt Papier zwischen uns! Ich halte mich an das, was mir das lebendige Herz sagt, und wenn dies nicht deutsches Gebiet ist, so folgt daraus nur, daß unsere Grenzen zu eng sind. Es ist deutsch, es war deutsch und es wird deutsch sein, ich sage es Ihnen, denn nur im Gefühl ist Wahrheit. Haben Sie Feuer?«
»Mit Gefühl hätten Sie niemals die schwedischen Streichhölzer erfunden. Das ist kein Kulturprinzip.
Warum stehen Sie jetzt hier? Weil man die Eisenbahn hat, aber die gefühlvollen Plattdeutschen haben dem Papin auf der Fulda die erste Dampfmaschine zerschlagen. Erst lassen Sie uns etwas lernen, dann mögen wir schwärmen. Wären die Schutthalden drüben nicht künstlich aufgeforstet — doch lassen Sie uns gehen, die Sonne steigt und Ihre Cigarre brennt längst.«
Die Wanderer verloren sich aufwärts in den Wald.
»Welcher von den beiden war denn der Mensch?« fragte Tröpfchen.
»Natürlich der mit der Eierschale,« erwiderte das Farnkraut. »Er brachte uns seine Huldigung, wir sind nämlich die sogenannte Natur.«
»Wie schön er sprach,« sagte Tröpfchen. »Ich habe ihn nicht verstanden, aber er hatte so etwas Wegwerfendes, und beinahe hätte er mich getroffen.«
»Wer spricht da unten?« klang es von oben aus der Fichte. »Sind Sie es, Kalkstein? Jetzt haben Sie doch einmal gehört, daß Sie keine Bildung haben. Sie werden nie die schwedischen Streichhölzer erfinden, aber aus mir können noch welche werden.«
»Es sind unten das Farnkraut und ein kleiner Tropfen, die sich vorlaut benehmen. Was aber das Menschengerede anbetrifft, so könnte ich mich eher darauf berufen als Sie. Doch ich thu's nicht. Gefühl ist Gewäsch und nicht Charakter. Und was die Menschen darunter verstehen, mag schönes Zeug sein. Übrigens ist es noch garnicht bewiesen, daß dies Menschen waren.«
»Ich habe mich also geirrt,« sagte Farnkraut zu Tröpfchen, »es waren gar keine Menschen.« Und es nahm sich vor, nie wieder etwas zu sagen, bevor sich der Stein geäußert hätte.
»Dann möchte ich aber doch einmal die Menschen kennen lernen,« rief Tröpfchen. »Ich will hinunter zu ihnen.« Damit ließ es sich auf den Stein fallen und bat ihn um ein wenig Charakter.
»Den muß man sich selbst verschaffen,« sagte der Kalkstein. »Nimm Dir von mir, soviel Du losbringst.« Und Tröpfchen sog an dem Stein, aber es konnte nichts lösen.
»Es fehlt Dir an Bildung,« mischte die Fichte sich ein. »Ich will Dir etwas Geistiges mitgeben. Könnte ich mit Dir wandern zu den Städten der Menschen und ihrer Weisheit lauschen! Wie glücklich müssen sie sein!«
Die Fichte rauschte mit ihren Ästen, die Luft strich über das Tröpfchen, und es saugte die Kohlensäure ein. Und da auf einmal konnte es den Kalk vom Steine nagen, und nun merkte es, daß es hartes Wasser geworden sei. »Das ist doch schon etwas,« dachte es. »Bildung und Charakter habe ich, nun noch ein wenig Glück, und ich kann es mit den Menschen aufnehmen.«
Eben wollte es in den Bach springen, um fortzueilen, als sich aus dem Walde Gesang vernehmen ließ. Ein einzelner Wanderer kam den Berg herab, rüstigen Schrittes. Auch er hielt an der Fichte an und blickte hinaus in die Sonnenlandschaft.
Einsam und still war's jetzt ringsum. Nur unten ein fernes Plätschern des Bachs, oben ein leises Summen von Insekten am Waldrand, wo die Sonne auf die Wiese schien. In bläulichem Dunste schimmerten die Schatten, der Atem des Sommertages hob sich von Gras und Blüten. Ein gelber Falter flatterte von der Halde herüber und breitete seine Flügel auf dem Steine aus.
Des Wanderers Augen leuchteten im Schauen. Kein Laut kam von seinem Lippen, und doch hörten es Wald und Berge, Luft und Bach, was seine Seele sprach:
Traute Heimat! Träumst du noch immer
Im stillen Glanze grünender Fluren
Meiner Jugend
Langentbehrte, glückliche Träume?
Immer noch ragst du, zackiger Fels,
Aus der Wipfel strebendem Kranz,
Immer noch schaut ihr, einsame Tannen,
Von euerer Höhe schweigend herab.
Fest und treu im geschlossenen Kreise
Engen Genügens waldiger Berge
Haftet die Seele, die heimatfrohe,
Und der zögernde Hirte
Treibt, wie Damon, die Herden aus.
Doch was glänzt dort am sanften Hang
Wogender Feldfrucht leuchtendes Gelb?
Wo dem Knaben der dornige Strauch
Zwischen Geröll und welkendem Grase
Einst nur spärliche Beeren bot,
Rieseln Bächlein
Dem Halm Erquickung zu,
Zog die Pflugschaar
Segenspendende Bahnen.
Was ringt sich herauf,
Weiß glänzendes Band,
Am steilen Hang,
Am gesprengten Felsens'
An des Gebirgs verwitternder Mauer
Klammert die sprossende Menschheit
Sich mit kletternden Ranken an.
Wo doch wurzelt die treibende Kraft,
Himmel und Erde die Säfte entringend
Zur unendlichen Arbeit?
Siehe, was hebt sich in dämmernder Ferne,
Wo der bleichere Himmel
Ringender Geister, emsiger Hände
Rastlos schaffende Sorge deckt?
Aus leichtem Rauch zum Gebilde geballt
Trittst du hervor,
Meinen sterblichen Augen
Enthüllst du dich gnädig, göttliches Bild,
Genius der Menschheit!
Das Haupt erhebst du,
Und geordnet im Raume
Rollen die Sterne gemessene Bahnen,
Zucken des Äthers leuchtende Wellen,
Strömen die Körper nach festem Gesetze,
Und im Zwang des geregelten Wirbels
Zu ewigem Kreislauf
Beugt sich Natur.
Im All verloren auf Weltenstäubchen
Soll ich verwehen, ein Spiel der Zeit,
Ziellos vernichtet?
Du senkst, o Genius,
Den schaffenden Blick in die eigene Brust,
Du hebst ihn aufs neue —
Und siegreich durchs All
Leuchtet ein Wort, —
Weit über den sausenden Sternen
Und über der Zeit zerstörendem Abgrund
Schuf es dein Wille im Menschenherzen:
Pflicht, du erhabener, großer Name!
Andächtig und ernst in der Freiheit Würde
Hör' ich die Stimme des eigenen Busens:
»Du sollst!« — —
Doch Stürme toben ums stolze Haupt,
In wilden Wogen brausen und schwellen
Die zwingenden Mächte ums schwache Bollwerk
Des hoffenden Herzens.
Wir zagen und schwanken,
Der inneren Stimme heilig Gebot
Gestürzt zu schauen im Wirken des Tages.
Und wiederum hebst du,
Genius der Menschheit,
Die leuchtenden Augen.
Unendlicher Liebreiz umspielt das Antlitz.
Die tobenden Stürme, die wilden Wogen
Stürzen melodisch zusammen zum Reigen.
Die kühlen Sterne, in ihrem Kreislauf
Wärmer erglühend, erzählen von ferner,
Seliger Zukunft holdem Gedeihen.
Freundliche Engel schweben im lichten,
Purpurnen Äther;
Das erhabene Wort des erfüllten Gesetzes
Im reinen Herzen
Gießen sie Frieden ins schwanke Gemüt.
Natur und Pflicht
Vereinst du, o Menschheit,
Im allumfassenden Schöpfergefühle
Wonnig zerfließend,
Und schmiedest die Welt
Zur reinen Gestaltung unendlicher Schönheit
Im Blicke der Liebe!
Dort seh' ich dich walten
Durch Nacht zum Lichte,
Ewige Menschheit!
Nimm deinen Sohn in die Mutterarme
Und laß mich wirken
An deinem liebenden Herzen,
Heilige, schaffende Menschheit!
Der Wandrer stieg zu Thale, seine Schritte verhallten.
Tröpfchen aber, berauscht vom hohen Liede der Menschheit, das in seinem kleinem Herzen nachbebte, zögerte nicht länger. Die gepriesenen Menschen wollte es drunten selbst aufsuchen. Es ließ sich abwärts rollen, und die Strudel des Baches führten es fort. Was die Fichte rauschte und der Felsblock brummte, drang nicht mehr bis zu ihm.
Als Tröpfchen ins Thal kam und der Lauf des Wassers langsamer wurde, da begann es bald sich zu langweilen. Es hatte gedacht, nun würden die Überraschungen und Neuigkeiten sich drängen; statt dessen glitt es stetig im Flüßchen dahin, wurde Tage hindurch an einer Schleuße gestaut und erblickte nichts als niedrige, grüne Uferränder. Es hatte Mühe, sich sein bischen Charakter und Bildung zu bewahren, um nicht ganz in der großen Masse zu zerfließen. Manchmal kamen Tiere zum Wasser, um zu trinken, und Menschen, um zu schöpfen. Aber Tröpfchen wurde nicht getroffen.
Eines Abends jedoch fühlte es sich auf einmal emporgehoben, und als es umschaute, fielen die Strahlen der untergehenden Sonne durch das Glas einer dunkelgrünen Flasche, in welcher es sich unversehens gefangen hatte. Ein Mann hielt sie gegen das Licht, er war noch jung, aber bleich, und düster war sein Blick.
»Du hast auch lange nichts gesehen als Wasser,« sagte er zu der Flasche.
»Ich dachte, es würde auf ein Maß Wein reichen für die kranke Frau, aber bei der Ablöhnung — ja, Mahlzeit! da gab's einen Abzug dafür und einen dafür — Und dabei muß man's Maul halten, wenn man nicht vor der Thür sitzen will. Verdammt!«
Er nahm einen Zug aus der Flasche. Tröpfchen klammerte sich ängstlich an den Boden, um nicht verschluckt werden.
Der Mann stellte die Flasche neben sich, holte eine Pfeife heraus und suchte den letzten Tabak in seiner Tasche zusammen.
»Er ist auch wieder teurer geworden,« murrte er, »kaum bringt man's noch zu einer ordentlichen Pfeife. Und bei allem Sparen will's nicht einmal zur Miete reichen. Wär' nur die Frau erst wieder gesund!«
Er schüttelte die Flasche, daß Tröpfchen jämmerlich zerstoßen wurde.
»Hol euch der Teufel!« rief er dann, und spritzte den Rest des Wassers zurück in das Flüßchen. Ein Glück, daß Tröpfchen wieder ins Wasser fiel, und noch dazu so schön rund, wie jemals. Da rann es weiter dahin und zerbrach sich den Kopf über das Heil der schaffenden Menschheit.
Am Morgen kam Tröpfchen durch ein Dorf. Der kleine Fluß war seicht geworden; Gänse und barfüßige Kinder wühlten den Schlamm auf, daß Tröpfchen nicht recht sehen konnte. Es schlüpfte in einen schmäleren Kanal und fand sich zwischen Bäumen und Gärten. Eben sprang es übermütig in die Höhe, um ein paar Sonnenrosen zu bewundern, die mit dummen Gesichtern herüberglotzten. In diesem Augenblick wurde es dunkel; Tröpfchen saß in einer Gießkanne, mit welcher eine Frau Wasser geschöpft hatte. Sie schritt auf das Haus zu, um die Blumen vor dem Fenster zu begießen, aber als sie eben beginnen wollte, bemerkte sie das Heranrollen eines Wagens. Schnell trocknete sie die Hände an der Schürze und lief in das Haus. Die Gießkanne blieb unmittelbar unter dem offenen Fenster stehen.
Tröpfchen konnte nichts sehen als ein kleines Stück blauen Himmel und eine Ranke wilden Weines, die sich im Lichte dehnte. Aber nun hörte es etwas. Vom Fenster her erscholl ein Choral aus Kinderkehlen, dann die tiefere Stimme des Lehrers und regelmäßige Antworten im Chore.
Aha, dachte Tröpfchen, hier ist eine Schule, hier giebt es Bildung. Das wäre etwas für die Fichte!
Wenn ich nur besser verstehen könnte! Und als es so recht angestrengt aufpaßte, hörte es den Lehrer erklären, wie die Welt in sechs Tagen sei geschaffen worden. Und zuerst war alles Wasser und finster darauf, dann aber wurde es hell; und der Himmel ward als ein festes Gewölbe zwischen die Wasser gesetzt und zwei Lichter darauf befestigt, Sonne und Mond. Dann erklärte der Lehrer, wie die Pflanzen und Tiere und Menschen wurden und wie sie alle eingerichtet seien ganz genau so, wie sie's gerade am besten brauchen könnten.
Tröpfchen war selig. Nun weiß ich doch, wie die Welt geworden ist und wie's in ihr zugeht! Was man nicht alles von den Menschen lernen kann!
Es entstand ein fröhliches Lärmen. Mit Freudengeschrei drängten die Kinder aus dem Hause — die Schule war vor der Zeit geschlossen worden. Aber nun hörte Tröpfchen in dem Zimmer noch eine laute, etwas schnarrende Stimme. Die Stimme war ihm doch bekannt? So hatte der Mann mit den Eierschalen geredet.
»Mit Ihren Leistungen bin ich nicht unzufrieden, Herr Lehrer. Aber in einer anderen Beziehung muß ich Ihnen meine ernste Mißbilligung aussprechen. Ich sehe da eine Zeitung auf Ihrem Tische, die mir nicht gefällt. Ein solches Blatt mit zersetzenden Tendenzen gehört nicht in die Hand des Volksschullehrers. Es ist mir berichtet worden, daß Sie sich auch anderweitig agitatorisch beteiligt haben. Bedenken Sie, daß Sie die Jugend vor allem zur Unterordung zu erziehen haben, daß aber ein solches Beispiel Sie zur Ausübung Ihres Amtes unfähig macht. Ich verwarne Sie und —«
Ein unterdrücktes Schluchzen unmittelbar neben Tröpfchen verhinderte es weiter zu hören. Die Frau hatte sich unter das Fenster gestellt um zu lauschen. »Es ist unser Unglück, ich hab's ihm ja gesagt,« seufzte sie.
Das Fenster wurde von innen geschlossen. Die Frau trat erschrocken zur Seite und stieß dabei die Gießkanne um. Das Wasser floß zum Teil über das Beet, zum größten Teil in die gepflasterte Abflußrinne, die sich unmittelbar an der Mauer hinzog, und von hier führte ein hölzernes Rohr direkt in den Kanal.
Tröpfchen gelang es nach manchen Fährlichkeiten und ritterlichem Kampfe mit einem Strohhalm und einer überraschten Kellerassel sein altes Bett wiederzuerreichen. Es hatte sich noch nicht von seinem Schrecken erholt, als es in einen kleinen Teich gelangte, wo es große Mühe hatte überhaupt vorwärts zu kommen. Aber hier gewann es eine hübsche Aussicht.
An dem flachen Ufer standen unter schattigen Bäumen Tische und Bänke, und Menschen saßen ringsumher, singend und trinkend, und fast alle hatten bunte Mützen auf dem Kopf und farbige Bänder um die Brust. Und mitten unter ihnen, zur Rechten des ehrfurchtsvoll auf ihn blickenden Präsident, saß Tröpfchens alter Naturfreund, der Mann mit den Eierschalen, und sang eifrig mit den Refrain des Liedes, der lautete: »Frei, frei ist der Bursch!«
Als das Lied zu Ende war, erhob er sich, setzte seinen Kneifer zurecht und sprach:
»Liebe Brüder, liebe junge Freunde! Eben auf einer Inspektionstour begriffen, begegne ich euch auf euerem Katerbummel. Da muß ich euch doch auf ein paar Minuten guten Tag sagen, unter den deutschen Linden, im freien Lufthauch der Natur. Ja, frei, frei ist der Bursch! Aber nur der Doktrinarismus fabelt vom Zwange des Philisteriums. Wir, die wir im Gefühl festhalten den heiligen Pulsschlag der Natur, wir wissen, daß der gekappte Obstbaum die edleren Früchte trägt! Über dem niedergebeugten Grase erhebt sich stolz die blühende Linde. Die Natur ist aristokratisch! Unsere ledernen Sohlen treten das Gras der breiten Erde, aber die bunte Mütze heben wir in den weiten Äther. Das ist die Harmonie der Freiheit, wie das farbige Spektrum aus der Berührung von Licht und Regen seinen Bogen über das Firmament zieht. Auf seiner Brücke wandeln wir nach Walhall wie unsere Heldenväter. Auf das Alter folgt die Jugend, so soll es heißen! Es lebe die Jugend! Es lebe die Natur! Es lebe die Freiheit!«
Der Präside schmetterte mit seinem Schläger auf den Tisch.
»Silentium für einen Salamander auf unseren alten Herrn — —«
»Die hätten wir,« sagte eine Stimme unmittelbar neben Tröpfchen. »Argyroneta aquatica, da wird es nicht fehlen! Schönes Exemplar, samt dem Neste.«
Mit Entsetzen sah sich Tröpfchen neben einer kleinen Wasserspinne in ein Glas gesperrt. Bei der eifrigen Beobachtung des Redners, bei der Bemühung ihn zu verstehen, hatte Tröpfchen nicht bemerkt, daß es dem jenseitigen Uferrande zugetrieben war und sich schon dicht an den Blättern einer Wasserpflanze befand. Und nun war es zugleich mit der Spinne gefangen worden. Der Mensch verschloß das Glas und steckte es vorsichtig in seine Tasche.
Es war finster und sehr unheimlich in der Flasche; Tröpfchen wollte vermeiden mit der Spinne in Berührung zu kommen. Aber all seine Erlebnisse und besonders das letzte Abenteuer bewegten es so lebhaft, daß es gar zu gern eine Frage gethan hätte. Schließlich siegte der Bildungstrieb über den Charakter und es sagte zur Spinne:
»Glauben Sie, daß dies ein Mensch war, der uns in die Tasche gesteckt hat?«
»Was ist das, ein Mensch?« fragte die Spinne.
»Das wissen Sie nicht?« erwiderte Tröpfchen erstaunt. Da kommen Sie bei mir an die richtige Quelle, denn ich bin auf einer Studienreise über den Menschen begriffen und habe ihn kennen gelernt. Er ist ein mächtiges Geschöpf, er verehrt uns, denn wir sind die Natur, er weiß auch, wie die Welt geschaffen ist —«
»Welt?« sagte die Spinne. »Kenne ich auch nicht. Ist das auch eine Spinne?«
»Das ist Wasser und Luft, Erde und Licht zusammen, und wenn das nicht wäre, so wären wir auch nicht.«
»Oho,« erwiderte die Spinne, »Sie vergessen, daß ich ein Haus habe, und das mache ich selbst, und die Luft bringe ich hinein, und was den Menschen anbetrifft, so fragt es sich, ob er überhaupt Lungen hat, und wieviele?«
»Das kam auch in der Schule vor, zwei Lungen hat er.«
»Nun, soviel habe ich auch. Und wieviel Beine?«
»Auch zwei, manche sagen vier —«
»Das ist gar nichts, denn ich habe deren acht. Und wieviel Augen?«
»Auch zwei.«
»Lächerlich, ich habe acht! Und wieviel Spinnwarzen?«
Die hat er gar nicht.«
»Keine Spinnwarzen? Und da wollen Sie in meiner Gegenwart vom Menschen reden? Schämen Sie sich! Ein erbärmliches Tier muß das sein!«
»Allerdings, zwei habe ich kennen gelernt, die nichts hatten. Der eine hatte kein Geld und der andere hatte keine Freiheit, oder vielleicht ist auch beides dasselbe. Indessen, ich befand mich damals in einer Zwangslage, das eine Mal in einer grünen Flasche und das andere Mal in einer Gießkanne, so mochte ich die Sache nicht recht übersehen können. Als ich aber im Freien war, da habe ich einen reden hören, — wenn ich ihn verstanden hätte, so könnte ich Ihnen beweisen, daß die Menschen sehr glücklich sind.«
»So lange Sie nicht beweisen, daß der Mensch eine Spinne ist, und zwar eine Wasserspinne, kann mir das Alles nicht imponieren. Da ich jetzt satt bin, so will ich mich herablassen und Ihnen sagen, warum. Ich bin nämlich das einzige Wesen. Die anderen sind nur da, weil ich sie sehe, atme oder esse. Meine Beute fange ich selbst, mein Netz spinne ich selbst und meine Fäden ziehe ich ebenfalls selbst. An Ihre sogenannte Welt glaube ich nicht, und an den Menschen auch nicht, und wenn ich gesättigt in meiner Luftblase sitze, so ist der Weltzweck erfüllt. Und so ist es!«
»Aber erlauben Sie, Sie sitzen jetzt in einer Flasche und müssen es sich gefallen lassen, —«
»Und läßt sich Ihr Mensch nichts gefallen?«
»Das wohl, aber er leugnet auch nicht die Außenwelt —«
»Das mag bei ihm richtig sein, aber außer mir giebt es nichts, und das würden Sie einsehen, wenn Sie den richtigen Begriff der Existenz hätten. Denn der Mensch, der mich in sein Glas steckt, beweist nichts. Nicht er hat mich, sondern ich habe mich selbst in seiner Tasche. Und wenn ich hier verhungern sollte, so würde das wieder nur mich allein angehen. Von dem Menschen werde ich erst etwas merken, wenn er sich bemühen wird, an mir, als dem einzigen Wesen, teilzunehmen. Ich werde ihn teilnehmen lassen, wie ich Sie teilnehmen lasse. Ich bin die Welt, aber ich gestatte Ihnen, in mir zu sein.«
Bei diesen Worten der Spinne fühlten sich Tröpfchen und Spinne durcheinandergeschüttelt, dann wurde es hell um sie. Der Mensch hatte die Flasche zwischen eine Reihe anderer auf einen Tisch in die Nähe des Fensters gesetzt. Die Spinne wurde samt ihrem Neste aus der Flasche genommen, und dabei blieb Tröpfchen im Innern des Flaschenhalses hängen und wurde wieder rundlich. Es blieb recht lange allein und sah sich nach einer Unterhaltung um.
Unter den Flaschen stand eine von besonders eleganter Gestalt mit einem schönen Zettel beklebt; darauf war ein goldener Rand und bunte Schrift. Das war gewiß etwas Vornehmes, und Tröpfchen dachte, ob es wohl auch einmal so etwas Feines werden könne, wie die Flüssigkeit in der Flasche.
Da klang es auf einmal aus der Flasche:
»Du kommst mir so bekannt vor, da drüben. Sind wir nicht schon einmal zusammen in einer grünen Flasche gewesen und dann wieder in den Fluß gegossen worden?«
»Richtig, ich erinnere mich,« sagte Tröpfchen. »Wir waren Nachbarn, aber wie bist Du so vornehm geworden?«
»Ja, das bin ich, obgleich ich nichts weiter als Wasser bin, aber ich bin Schönheitswasser, und nachher werde ich chemisch untersucht werden. Denn ich koste fünf Mark die Flasche.«
»Und wie hast Du das fertig gebracht?«
»Ich kam in ein großes Bassin und lange Zeit durch dunkle Röhren, und dann floß ich aus einem goldenen Hahne heraus. Dort waren viele hundert Flaschen, wie die, in der Du mich siehst, und ein Mensch ließ sie alle voll Wasser laufen, und in jede that er noch einen kleinen Tropfen aus einer andern Flasche, daß wir alle wunderschön rochen. Da waren wir Schönheitswasser geworden, und die Menschen kamen und kauften uns für fünf Mark die Flasche. Eine Dame nahm mich mit vier andern Flaschen zusammen, da war es etwas billiger. Und jeden Morgen that sie etwas in ihr Waschwasser. Da wurde sie immer schöner.«
»Und wie kamst Du denn hierher?«
»Eines Abends war die Dame sehr ungehalten und warf die Blumen aus ihrem Haar in eine Ecke. Dann trat sie vor den Spiegel, sah sich lange darin an, und endlich rief sie:
»Sie ist doch nicht schöner, die blonde Gans! Und sie hat auch Sommersprossen! Aber das Wasser taugt nichts!«
Den andern Tag schickte sie mich hierher, und nun werde ich wohl noch etwas Vornehmeres werden.«
»Kann man das?« fragte Tröpfchen. »Was kann man denn noch werden, vielleicht eine Welt, wie die Spinne?«
»Herzblut!« sagte eine Stimme auf dem Tische. Tröpfchen sah sich um, da lag ein Glasstreifen mit Papier beklebt. »Ich war auch einmal ein Wassertropfen, und jetzt bin ich Herzblut, aber getrocknetes. Denn ich bin auf Bacillen untersucht.«
»Herzblut kenne ich auch,« rief ein alter Feuersteinsplitter, der daneben lag. »Aber es ist rot und warm, das weiß ich noch. In Yukatan war's, auf einem großen Gebäude, hoch über der Stadt, und viele Stufen führten hinauf. Damals war ich noch ein scharfes Messer, und ein herrlich gekleideter Mann schwang mich über einem breiten Steine. Auf dem Steine aber lag ein Mensch, den hielten vier andere. Und ich fuhr in den Menschen, da rissen sie ihm das Herz heraus und hielten es in die Höhe, damit sich die Sonne freute. Und alle die zusahen, freuten sich auch, weil sich die Sonne freute. Aber das ist schon lange her!«
»Und weiter kann man nichts werden?« fragte Tröpfchen.
»Doch, wenn man Glück hat, und das Herz wird nicht auf einmal herausgerissen, sondern nur alle Tage ein wenig, daß der Mensch alt dabei wird.« Der das sprach, war ein bleicher Menschenschädel, der auf dem Schranke stand.
»Und was wird man dann?«
»Eine Thräne.«
Tröpfchen konnte nicht weiter fragen. Die Spinne wurde wieder in die Flasche gethan und der Deckel geschlossen.
»Wie ist es Ihnen ergangen?« fragte Tröpfchen.
»Es hat mich etwas an meinem Beine gekratzt,« sagte die Spinne. »Vielleicht war es der Mensch.« Und damit fing sie an ein neues Haus zu bauen.
Der Mensch hatte mit der Spinne auch einige kleine Insekten in das Glas gethan, natürlich zur Nahrung für die Spinne; und das imponierte Tröpfchen nicht wenig. Vielleicht ist sie doch die Welt, dachte es.
Am andern Tage wanderte das Glas wieder in die Tasche. Als der Mensch es aufs neue herauszog, hielt er es in die Höhe und redete laut vor einem großen Kreise von Zuhörern, die auf ihn hinblickten.
»Wahrhaftig,« sagte Tröpfchen zur Spinne, »die Menschen sind Ihretwegen hier.«
»Es dreht sich alles um mich,« erwiderte die Spinne und blähte ihr Nest auf.
Der Mensch aber sprach: »Was Sie hier sehen, meine Herren, ist nichts Besonderes — eine gewöhnliche Argyroneta; und nicht um Ihnen die Spinne zu zeigen, brachte ich sie mit. Aber an ihren Beinen lebt ein kleiner, mit bloßem Auge kaum sichtbarer Ektoparasit aus der Gattung der Saugwürmer, Trematoda, den ich zu Ehren seines berühmten Entdeckers Mystozoon Schleiermeier genannt habe. Ich stelle Ihnen denselben vor.« —
Es wurde auf einen Augenblick dunkel im Saal, dann erschien auf einer großen Leinwand das Saugwürmchen in zehntausendfacher Vergrößerung, als ein scheußlicher Drache, mit Schuppen, Stacheln, furchtbaren Saugnäpfen und Zangen.
Wenn das auf der Spinne lebt, dachte Tröpfchen, so stecken wir doch vielleicht alle in ihr.
»Ich bin die Welt,« sagte die Spinne.
»Aber auch dieses kleine Geschöpf, welches auf den Beinen von Argyroneta schmarotzt, fuhr der Redner fort, »auch dieses ist es noch nicht, was uns interessiert.
Ich hatte das Glück, in den Saugnäpfen dieses Parasiten einen Afterparasiten zu entdecken, Ursula clarior« — ein neues Untier erschien auf der Leinwand — »und in dem Ganglionknoten desselben eine noch unbekannte Bakterienart, ich nenne sie den Punktbacillus.
Er ist das kleinste Lebewesen, welches wir kennen — aber, meine Herren, ich bin stolz, Ihnen dies zuerst sagen zu dürfen, wir stehen hier vor einer Entdeckung von unübersehbarer Tragweite. Ich habe im Gegensatz zu berühmten Theorien den Übergang von Bacillenformen in einander nachgewiesen. Aus dem Parasiten Ursula entwickelt sich das im Blute des Menschen schmarotzende Polystoma Lurcium. Mit ihm dringt der Punktbacillus in das menschliche Nervensystem, und hier wird daraus der Gedankenstrich-Bacillus. Und nun, meine Herren — es ist mir gelungen, durch eine Reihe von Reinkulturen aus dem Punktbacillus den Gedankenstrichbacillus zu züchten; von diesem aber habe ich in Gemeinschaft mit meinem Kollegen Musitanus nachgewiesen, daß er es ist, welcher die Zersetzung der Gehirnsubstanz bewirkt. Kein Gehirnvorgang ohne Bakterienwachstum, kein Gedanke ohne Bacillus! Er ist es, der in uns denkt! Und so, meine Herren, habe ich Ihnen den Bacillus logicus in seiner Entstehungsgeschichte aufgezeigt. Seine künstliche Kultur ist nur noch eine Frage der Zeit, und seine Einimpfung in das Blut wird den europäischen Denkprozeß beschleunigen. Ein paar Bacillen weniger oder mehr, und ein Narr oder ein Philosoph steht vor Ihnen; ein lebhafterer Spaltungsprozeß, und aus dem Cretin wird ein Kant!
Meine Herren! In dem Schmarotzer eines Schmarotzers einer Spinne lebt ein Organismus, von welchem tausend Millionen noch nicht ein Milligramm wiegen, und in ihm sehen Sie die Urform, ja den Herrn alles Lebens, nicht bloß alles Lebens, nein, aller Kultur! Als einfache Zellen sind die Bacillen Urform, aber da sie nicht assimilieren, sondern nur zersetzen, sind sie der ewige Gährstoff, der an unserm Leben nagt. Sie herrschen über uns unzugänglich und unverstanden wie Götter. Sie dringen in unser Blut und vernichten die bauende Arbeit unseres Leibes, sie dringen in unser Gehirn, und die Gedanken des Entdeckers blitzen auf. Und wieder mitten im siegreichen Schaffen des Genius zernagt das Bacillenheer unsere Lebenssäfte, und die Ideale der Menschheit sinken in Nacht mit ihren Trägern. Doch was wollen wir? Was sind wir anders als eine Bacillenkolonie auf der Erde, Schmarotzer am Leibe der Pflanzenwelt? Denn auch wir besitzen kein Chlorophyll, auch wir können nicht unmittelbar die Elemente assimilieren. Der Bacillus ist unser Herr und unser Bruder. Ist er unser Vorbild, das Ziel, dem wir zustreben und das er schon erreicht hat, das Ideal des Parasitentums, weil er einzellig für sich schmarotzt? Oder sind wir die höhere Stufe, weil unser Körper ein Zellenstaat parasitischen Charakters ist? Wer möchte das entscheiden, der nicht der Entwickelung des Weltprozesses beigewohnt? Wie kam das Leben auf die Erde?«
Das wenigstens weiß ich, dachte Tröpfchen.
»Als der Glutball der Erde aus dem planetarischen Nebel sich ausschied und erstarrte, als nach Jahrmillionen im schlammigen Grunde des heißen Urmeers zwischen komplizierten Molekülen die ersten diosmotischen Erscheinungen auftraten, da war die Geburtsstätte des Protoplasmas. Aber war es auch die Geburtsstätte des Bacillus? Wieviel Millionen von Jahren mußten weiter verfließen, ehe die Bedingungen seines Lebens erfüllt wurden, da sie das Leben der andern voraussetzen? Nein, meine Herren, der Bacillus ist keine Urform, er ist die Endform alles Daseins, er ist das höchste und vollkommenste Wesen in der Welt des Lebens! Der Mensch herrscht über die Natur, aber der Bacillus herrscht über den Menschen. Der Mensch bewohnt das Planetensystem, aber der Bacillus bewohnt den Menschen. Welches Weltsystem mag er sich von dem komplizierten Weltsystem seines lebendigen Wohnorts entworfen haben? Wie berechnen seine Astronomen den Umlauf des Blutes? Wonach bestimmen seine Staatsmänner die Anlage von Kolonien? Welches mögen seine sittlichen Maximen sein? Sicherlich besitzt er solche! Denn rücksichtslos wie der Mensch zerstört er fremdes Leben zu eigenen Zwecken, wandelt er die Natur um durch seine Arbeit. Und unaufhaltsam vermehrt sich sein Geschlecht. Meine Herren! Denken Sie sich einen Riesen, der das Gewimmel der Menschheit auf der Erdoberfläche durch ein Mikroskop beobachtet — was würde er erblicken? Sähe er die Mutterliebe, die Gottesfurcht, das Mitleid in unsern Herzen? Sähe er den Mut des Helden, die Begeisterung des Forschers, die Ideale des Künstlers, die Wonne des Liebenden? Nein, er sähe nur Entstehen und Vergehen von Individuen, Anhäufung und Vernichtung von Massen, Änderungen der örtlichen und zeitlichen Gruppierung — alles, was wir an den Bacillen sehen. Mit welchem Rechte wollen wir dem Bacillus, den wir nur von außen beobachten, alles das absprechen, was auch an uns niemand von außen wahrnehmen könnte? Warum soll nicht in ihm ein Microbacillus logicus vegetieren, der in ihm den logischen Spaltungsprozeß bewirkt, wie in uns? Wo sind die Grenzen des Universums? Darum, meine Herren, Achtung vor dem Bacillus, Achtung vor dem Mächtigsten im Kleinsten! Sammeln wir uns und bedenken wir, daß wir nicht einmal Bacillen sind!«
Der Redner verließ seinen Platz, die Zuhörer gingen nach Hause. Eine Scheuerfrau kam mit Besen und Eimer. Das Glas mit dem Tröpfchen und der Spinne war vergessen, und da der Deckel offen geblieben war, so hatte sich die Spinne davongemacht. Sie kroch über die Dielen.
»Eine Spinne!« schrie die Frau und stieß mit dem Besen nach ihr.
»Ich bin die Welt,« sagte die Spinne. Da war sie zerquetscht.
Der Parasit Mystozoon Schleiermeier und dessen Parasit Ursula clarior und dessen Parasit, der Punktbacillus, waren über die Möglichkeit eines Weltunterganges noch nicht im Klaren, als Tröpfchen sie aus den Augen verlor. Denn die Frau nahm das Glas, hielt es gegen das Licht und sagte: »Es scheint nur Wasser.« Sie roch daran. »Aber es stinkt.« Und damit hatte sie es in den Eimer gegossen.
Das waren schlimme Tage für Tröpfchen in dem finstern Kanale und in dem Klärbecken, wo sich der Unrat der ganzen Stadt absetzte. Wo ist nun die Welt? fragte es sich. War es die Spinne? Aber die ist ja zertreten. Und wie ist die Welt entstanden? Dieser Mensch mit den Bacillen war offenbar nicht der Ansicht, daß die Sache gerade so zugegangen sei, wie Tröpfchen in der Schule gelernt hatte. Wer hatte nun Recht? Soviel ist klar, dachte Tröpfchen, die Menschen wissen selbst nichts. Wie sollten sie auch, da sich doch selbst die Spinne geirrt zu haben schien. Was ist der Mensch? Nicht einmal ein Bacillus? Nun, Bakterien gab es hier genug, und Tröpfchen wußte ja jetzt, wie sie aussahen. Vielleicht konnte es von ihnen etwas erfahren. Sie schienen allerdings recht einsilbig.
»Was ist der Mensch?« fragte es die Bacillen.
»Unsere Hoffnung.«
»So seid Ihr das Leben?«
»Wir waren es und wir werden es.«
»Und was seid Ihr jetzt?«
»Der Tod.«
Tröpfchen befand sich wieder im Freien. Ein breiter Strom wälzte es mit seinen Wogen. Niedrig und grau zogen die Wolken und der Wind wehte kalt vom flachen Ufer her. Dort standen zwei Menschen eng verschlungen.
»Fürchtest Du Dich?« fragte er.
»Ich fürchte nichts als die Trennung von Dir.«
»Es giebt nur einen Weg, der uns vereint.«
»Er liegt vor uns, wir werden ihn gehen.«
»Fluch ihnen, die uns hineintreiben!«
»Nein, vergieb ihnen, denn wir werden Ruhe finden.«
»Armes, unglückseliges Weib, leb' wohl!«
»Ich bleibe bei Dir.«
Ein dumpfer Fall — entsetzt stob Tröpfchen in die Höhe — da waren ja Menschen selbst zu ihm gekommen! Aber sie wollten nicht reden. Vorüber — dem Meere zu, dem Meere!
Lange barg sich Tröpfchen im Meere. Welt und Menschen wollten ihm nicht gefallen. Da unten war's einsam. Es wußte nicht, wie lange es durch die Ozeane hin und her trieb, bis ihm eines Tages die Sehnsucht kam nach Fichte und Stein, bei denen es einst geweilt. Von der Höhe des Wellenkammes lugte es in die Ferne.
Ein Schiff schnitt eilend durchs Wasser mit geschwellten Segeln. Gebräunte Männer mit weißem Turban schauen rückwärts, sorgenvoll und finster. Dumpfes Klagen schallt aus dem Raume. Das Sklavenschiff jagt mit günstigem Winde. Aber schneller ist die graue Rauchwolke dort hinten, wo das Rollen des Schusses mahnend Halt gebietet und die Adlerflagge in die Höhe steigt. Die finstern Männer sehen nach ihren Waffen und fliegen der Küste zu. Aber näher schon donnert es herüber, im Schiff zerspringen die Geschosse, die braunen Räuber, die geraubten Schwarzen zugleich zerschmetternd. Haltet aus, der Sieger bringt euch die Freiheit! Haltet aus auf dem brennenden Wrack! Schon sind die rettenden Boote nahe, da sinkt der zerschossene Bau in die Flut. Die Menschlichkeit hat gesiegt, die Sklaven sind frei, wo wir alle frei sind.
Tröpfchen tanzt zitternd im hellen Sonnenstrahl auf der schäumenden Oberfläche — es wird ihm so leicht, so frei — es steigt empor, es schwebt in der Luft — durchsichtig und klar im blauen Himmelsraume — — Schon liegt das Meer weit unter ihm — noch eine Strecke — ach, wie kalt wird es hier — es zieht sich zusammen, es ist wieder ein Tröpfchen — nein, nicht eines, ein ganzes Wölkchen ist's, und langsam zieht's über das Schiff der weißen Männer. Was thun die Menschen? Die sie soeben grausam zerschmetterten, sie ziehen sie mühevoll aus den Wellen, sorgsam verbinden sie die Wunden. Der braune Araber wie der schwarze Neger, der gefangene Herr und der befreite Sklave liegen nebeneinander, und der weiße Mann kühlt ihnen die Stirn.
Woher das klare Eis in der Tropenglut? Woher die eilende Fahrt in der Windstille, die sichere Richtung in der Uferlosigkeit? Woher der glänzende Lichtstrom in der Nacht? Und Tröpfchen denkt des ernsten Mannes mit der hohen Stirn, dessen Forscherblick dem Geheimnis des Bacillus nachspähte, es denkt jenes andern Mannes mit den leuchtenden Augen, der das Lied sang von der ewigen, schaffenden Menschheit. — Weit über die Erde blickt es von der Wolke auf siegreiche Arbeit und mächtiges Gelingen. Die Wolke senkt sich, und wieder sieht es die Armen und Unfreien im Kampfe mit des Lebens Notdurft, sieht den Hochmut und die Herzlosigkeit, Verblendung und Überhebung, Dummheit und Schlechtigkeit, Iammer und Verzweiflung, wie jeder Einzelne rastlos ringt im Kampfe des Daseins. Die Wolke steigt, und nun überschaut es alle zusammen und es däucht ihm ein großes Werk, das sie schaffen. Und es schwebte hinauf, so hoch die Winde es tragen wollten, bis die Grenzen ferne verschwammen von Land zu Land, von Meer zu Meer — Noch lagerte das Dunkel dort unten, aber sein Wölkchen erglänzte golden im Frührot; und vor der Sonne herschwebend auf Geisterschwingen begegnete ihm der Genius des Tages und lächelte liebreich.
»Bringst Du ihnen das Glück?« fragte Tröpfchen.
Der Genius schwieg und schwebte lächelnd weiter.
Und Tröpfchen spähte hinab und dachte: Glücklich werden sie nicht dort unten? Aber würdig können sie werden des Glücks, hinabzuschauen mit mir von der Wolke, um zu begreifen, daß sie nicht anders sein können. Und also denkend zog es still den heimatlichen Bergen zu.
»Streitet nur weiter, Fichte und Stein: Bildung und Charakter, Denken und Wollen, Natur und Freiheit, braucht ihr nicht beide? Habt ihr nicht beide? Aber wo ließet ihr das Glück? Ich hab's nicht gesehen, wo ich vorbeizog, es muß wohl dort wohnen, wo Tröpfchen nicht hin kam, woher das Lied klang, das der Wanderer ersann am Waldesrand? Aber ich bin ja auch nur ein Wölkchen geworden, und keine Thräne —«
Die Abendsonne lag grüßend auf der Fichte, da stand das Wölkchen mit rosigem Scheine über ihr.
Auf dem Steine saß wieder jener Wanderer, doch nicht allein. Eine zärtliche Gestalt in hellem Gewande schmiegte sich neben ihn, und in ihren Schoß schüttete ein Kind fröhlich lachend einen Strauß von Haideröschen Aber plötzlich schreit der Knabe auf und zieht blutend die Hand zurück. »Sieh wie die bösen Dornen mich gestochen haben!« ruft er schon wieder lächelnd. »Warum müssen die Rosen Dornen haben?«
Der Vater nahm seinen Kopf zwischen die Hände und sagte ernsthaft: »Siehst Du das rosige Wölkchen dort oben? Würde es wohl so schön erglänzen, wenn nicht die Sonne jetzt unterginge und die Nacht heraufstiege? Hast Du nicht gehört vom starken Helden Siegfried, daß selbst ihn die Todeswunde treffen konnte? Es kann nichts geben in der Welt, nichts Herrliches, an dem nicht ein Flecken, nichts Gutes, an dem nicht ein Tadel wäre — das ist nun Menschenloos, daß auch dem Besten etwas fehlen muß.«
Aufmerksam lauschte der Knabe und schwieg nachdenklich. Dann wandte er die großen blauen Augen auf seiner Mutter freundliches Antlitz und fragte verwundert:
»Was fehlt denn aber an Dir?«
Die Mutter küßte ihren Liebling. Das rosige Wölkchen war verschwunden und auf die Locken des Knaben fiel eine Thräne des Glückes.
Gründlichkeit ist die Toilette des Gelehrten. Ohne dieselbe vor das Publikum zu treten, wird er nie wagen.
Nun aber ist es eine der wichtigsten Aufgaben jedes Autors, insofern er sich selbst als einen Kulturfaktor betrachtet, die Stellung seiner eigenen Persönlichkeit in der Geschichte des europäischen Denkens so weit zu klären, daß den künftigen Geschichtsschreibern kein Zweifel darüber mehr entstehen kann, wie wichtig für die Möglichkeit der Kulturentwickelung seine eigene Existenz gewesen ist. Schon die Rücksicht darauf, daß sich möglicherweise kein kongenialer Biograph finden könne, muß im Interesse der Vollständigkeit der Literaturgeschichte jeden Autor, sobald ihm der Litteraturkalender die Unsterblichkeit gesichert hat, dringend veranlassen, für alle Fälle seine Selbstbiographie vorzubereiten. Daß dies gründlich und fachlich geschehen muß, ist in Deutschland selbstverständlich; es ist auch leicht zu begreifen, daß man für schmückende Beiwörter wie »geistreich«, »wirkungsvoll«, »hochbedeutend«, »genial« und so weiter aus Bescheidenheit im Manuskript nur einen leeren Raum läßt. Insoweit muß man der Mit- und Nachwelt vertrauen. Im Übrigen aber bedarf die Einrichtung einer Selbstbiographie doch eines gewissenhaften Studiums, und da es unter den Autoren viel mehr Selbstbiographen als Philosophen giebt, so glauben wir durch unsere Untersuchung eine wesentliche Lücke in der Litterarur auszufüllen. Es fragt sich, welchen Teil einer möglichen Einleitung aus dem ungeheuren Stoffe der vorbereitenden Fragen wir aussuchen sollen, um ihn mit der uns unerläßlichen Vollständigkeit behandeln zu können.
Vor die Aufgabe einer Selbstbiographie gestellt, erwäge der Autor weniger die Frage, ob derselben ein Inhalt überhaupt zukommen kann, als vielmehr, nach welcher Methode sie abzufassen ist; und diese Frage wird um so wichtiger, je unwichtiger das Objekt bleibt.Ja, bei weiterem Nachdenken erschien mir das Problem der Methode so bedeutsam, daß ich beschloß, mich auf dieses zu beschränken, um es ein für allemal zum Besten aller Autobiographen zu lösen. Zwar ward es mir schwer, meine natürliche Bescheidenheit soweit zu überwinden, daß ich auf mich selbst zu exemplifizieren wagte; aber hier mußte meine Schüchternheit dem Interesse der Wissenschaft weichen. Und so schrieb ich diese Prolegomena, um eine Methode zu finden, welche die Autobiographie von dem willkürlichen Einfalle eines Dichters zur Höhe einer wissenschaftlichen Leistungzu erheben vielleicht nicht ganz ungeeignet zu scheinen erachtet werden dürfte.
Zugleich erkläre ich, daß etwaige Widersprüche, die sich in den einzelnenTeilen der Prolegomena finden sollten, lediglich auf das mangelhafte Verständnis des Lesers über den im entsprechenden Augenblicke vom Autor eingenommenen Standpunkt zurückzuführen sind.
Der bekannte traurige Verfall, in welchem sich unsereJugenderziehungjedesmal befindet, wenn bewährte Pädagogen das Bedürfnis fühlen, die Welt mit einem Epoche machenden Verbesserungseinfall zu beglücken—diese Versumpfung der nationalen Bildung hat es mit sich gebracht, daß unsere Kinder noch immer nicht gewohnt und gezwungen sind, biographische Jahrbücher ihres Erdenwallens herauszugeben. Wenn derartige Berichte von den Eltern bereits vor der Geburt der Sprößlinge begonnen und von diesen selbst, sobald sie mit dem Aufsteigen nach Quarta die mittlere stilistische Reife des gebildeten Deutschen errungen haben, gewissenhaft fortgesetzt würden, welche Fülle biographischen Materials würde dann geschaffen sein! Nicht eher werden wir es zu einer wissenschaftlichen Psychologie, Anthropologie und Sociologie bringen, bis wir nicht durch genaue Selbstbeobachtung der Individuen imstande sind anzugeben, warum gerade Fritz Müller am 19. August 1888, nachmittags 3 Uhr 12 Minuten, an dem Hause Gartenstraße 99 vorbeiging, und wann Auguste Schultze ihre erste zarte Seelenregung in ihr Tagebuch niederschrieb. Denn bekanntlich muß heutzutage jede Wissenschaft induktiv sein, wenn sie etwas gelten soll; darum brauchen wir zuerst den autobiographischen Stoffe, Stoff und wieder Stoff, dann werden wir auch die richtige Verwertung finden.
Ich will nur daran erinnern, wie leicht es auf diesem Wege wäre, das wichtige Problem des wahren Normalmenschen zu lösen. Der Fortschritt der Menschheit hängt davon ab. Bekanntlich hat niemand mehr Zeit, individuell zu sein; Generalisierung und Massenproduktion, das ist das Kulturziel. Man kam von der Familie zum Staate, von der häuslichen Brotbereitung zur Dampfmühle und Dampfbäckerei, vom privaten Kienspan zur Gasanstalt, vom lehrenden Haussklaven zur Volksschule und zur Staatsuniversität, von der Einzelwanderung zur Gesellschaftsreise. Man muß auf diesem Wege fortschreiten. Centraiheizung und Centraispeisung sind nur eine Frage der Zeit. Welche Volkswirtschaftliche Ersparnis aber müßte gewonnen werden, wenn es gelänge, die für das Gefühlsleben so unentbehrlichen Zustände der lyrischen Produktion, der Liebesschwärmerei und der Katerstimmung der Sorge des Individuums abzunehmen und zu centralisieren, sei es nun durch Verstaatlichung oder durch Gründung von Produktivgenossenschaften. Wieviel Mühe und Not macht es nicht dem Einzeljüngling, die nötigen Reime für seine zarten Gefühle aufzufinden, unter den Fenstern seiner heimlichen Flamme einherzustolzieren, die trüben Stunden, welche auf zu reichlichen Biergenuß folgen, mit Grübeleien über das zweifelhafte Los der Menschheit auszufüllen! Und wieviel kostbare Zeit der unwiederbringlichen Jugend geht dadurch verloren! Es ist einleuchtend, daß eine Organisation dieser unentbehrlichen sogenannten Jugendthorheiten dringend not thut, damit dieselben im großen betrieben werden können, was jedem einzelnen bedeutend billiger kommen würde. Alle volkswirtschaftlichen Analogien sprechen dafür.
Um aber derartige Anstalten gründen zu können, müßte man zunächst auf statistischem Wege genau festgestellt haben, wieviel Zeit der Normaljüngling mit lyrischen Gedichten, mit Fensterpromenaden und mit grauem Elende konsumiert. Und das ist nur möglich durch obligatorische Einführung autobiographischer Jahresberichte. Diese wären nach einem Normalschema anzulegen, und das statistische Bureau für Normalpsychologie hätte dann aus allen Einzelbeobachtungen das arithmetische Mittel zu nehmen. Die so gewonnene lyrische, erotische und katerologische Normalzeit wird alsdann in den zu gründenden Centraianstalten in gemeinschaftlichen Übungen verbracht, und es würde allen statistischen Ansichten Hohn sprechen, wenn nicht dadurch für die künftige Generation eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung des Entwicklungsprozesses erreicht werden sollte.
Dieses Beispiel, dem sich viele weitere Anwendungen der statistischen Normalmethode anschließen ließen, mag ausreichen, um die Wichtigkeit der autobiographischen Jahrbücher zu beweisen. Wüßte man nun aber durch dieselben erst genau, wieviel Zeit für den Normalmenschen zu jeder psychischen Arbeit erforderlich wäre, so würde sich durch die Abweichung vom Mittel sogleich für das Individuum ein Maß seiner psychologischen Eigenart ergeben. Fände man z. B. für die jährliche lyrische Normalzeit eines Zwanzigjährigen 325,6897 Stunden, und beobachtete man dann bei einem Individuum einen sehr bedeutenden Uberschuß von lyrischer Zeit, so würde daraus mit Sicherheit auf seine hervorragende lyrische Neigung zu schließen sein, und man würde mit Fug ihn in die lyrische Fachschule versetzen. Leider kennen wir trotz aller Goetheforschungen noch immer nicht Goethes poetische Zeit, d. h. das in Stunden und Minuten ausgedrückte Mittel seiner täglichen literarischen Produktion. Es gäbe dies offenbar die poetische Idealzeit, und man könnte sofort in Ziffern angeben, inwieweit ein Dichter dem großen Meister nahekomme. Die Ansprüche, welche Neuere in dieser Hinsicht erhoben haben, ließen sich dann leicht mathematisch prüfen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß die oft gehörte Klage, unsere Zeit produziere keine großen Dichter, ein für allemal durch die statistische Methode gründlich widerlegt würde. Die Zukunft wird derartige traurige Nergeleien über die litterarische Bedeutung der Schriftsteller nicht kennen. Das litterarisch-statistische Centraibureau wird alljährlich im Litterarurkalender die poetische Zeit neben dem Geburtsdatum der Autoren veröffentlichen, und der Dichterwert derselben wird gewiß sein. Die zu verteilenden Orden und Titel werden alsdann mit noch größerer Sicherheit an den Würdigsten fallen.
Leider ist es auch bei mir und von mir versäumt worden, meine literarische Zeit festzustellen; und wenn ich dies auch künftig thun wollte, es fehlt ja die Hauptsache, die Kenntnis der poetischen Normalzeit. Da nun bekanntlich keinem Autor daran liegt, auf Grund nicht völlig sicherer oder gar eigener Angaben herausgestrichen zu werden, ich aber in Ermangelung statistisch-mathematischer Grundlagen nicht imstande bin, einen Anspruch auf schriftstellerische Geltung nachzuweisen, so muß ich für meine Selbstbiographie die Anwendung der statistischen Methode verwerfen.
Die historische Methode für Autobiographien ist die gebräuchlichste. Man erzählt, ebenso wie es in den Annalen der Weltgeschichte geschieht, einiges, was man weiß, vieles, was man sich denkt, und alles, von dem man wünscht, daß die Nachwelt es glauben möchte. Es genügt jedoch nicht, etwa die Zeit des eigenen Lebens, an welche man sich erinnert oder über welche man Urkunden besitzt, dem Leser vorzufuhren. Der ernstere Autor geht tiefer. Er beginnt vor seiner Geburt, meistens schon vor der Geburt seiner Eltern oder Großeltern, und in günstigen Fällen vor der Geburt seiner sämtlichen Vorfahren. Indem man nämlich sich selbst als Erzeugnis einer biologischen Entwicklung auffaßt, wird man seine persönlichen Eigenschaften aus denjenigen seiner Voreltern zu erkennen vermögen, und dies um so besser, je weniger man von seinen Vorfahren weiß. Dies ist das Geheimnis der genealogisch-historischen Methode, welches ich den Lesern nicht vorenthalten will. Bekanntlich wird der historische Blick um so weiter und erhabener, je größer der überschaute Umkreis wird; mehr und mehr verschwinden die störenden kleinen und individuellen Züge, und das freie Auge erblickt den bestimmenden Charakter des Ganzen. Ist man nun auf einen so hohen historischen Standpunkt gelangt, daß man von der Wirklichkeit wenig und von seinen Vorfahren garnichts mehr sieht,
so hat man erst ein unbefangenes Urteil gewonnen. Man wird jetzt mit Leichtigkeit seine eigenen Charakterzüge in dem Geschick seiner Ahnen bedingt finden, weil diese Ahnen unter dem Gesichtswinkel des Enkels sich zeigen und sich ihm daher anbequemen. Dieser Standpunkt ist von hohem ethischen Werte: Was unsere Ahnen einst uns gaben, wir geben es ihnen dankbar zurück. Sie erzeugten uns, und wir erzeugen sie wieder. Aber wir sind die besseren; sie erzeugten uns, wie sie mußten, aber wir erzeugen sie, wie wir wollen. Wir können ihnen darum nicht böse sein, sie wußten ja nicht, was kommen würde, wir aber wissen, was vielleicht gewesen ist.
Ich habe Versuche gemacht, die genealogisch-historische Methode auf meine Selbstbiographie anzuwenden. Da ich ein geborener Schlesier bin, so würde es nicht schwer fallen, einen der alten Vandalenhäuptlinge als Urahnen anzusprechen; aber das kann mir nicht viel nützen. Daß diese Herren direkt von den Göttern abstammen, scheint mir historisch einigermaßen fragwürdig; sie müssen also irgend anders woher gekommen sein. Aber woher? Ich habe nun festgestellt, daß der Skythe Anacharsis, der Freund Solons und einer der 7 bis 22 Weisen Griechenlands, einer meiner direkten Vorfahren war; daß wir von seinen Söhnen nichts wissen, liegt nur an den mangelhaften standesamtlichen Einrichtungen der Skythen. Sicher ist, daß sein Vater Gnur hieß, und wenn man diesen Namen mit Anacharsis zusammenhält, so wird jeder Etymologe die Identität mit meinem Familiennamen sofort nachzuweisen imstande sein, wenn er gleich den letzteren gamicht kennen sollte. Außerdem bin ich im Besitz eines Briefes, in welchem Krösos von Lydien dem Anacharsis zur Geburt eines Söhnchens gratuliert und ihm die Absendung von 50000 Pfund Gold als Patengeschenk anzeigt. Letzteres hat sich leider nicht erhalten. Dagegen ist es wichtig, daß nunmehr die bisher noch fragliche arische Abstammung der Skythen wenigstens für die südlichen Stämme sicher ist und auf die Wanderungen germanischer Stämme ein neues Licht fällt.
Anacharsis hatte eine Abneigung gegen Faustkämpfe und gegen das mit Seekrankheit verbundene Befahren des Meeres, worin ich mich ihm völlig verwandt fühle. Außerdem schrieb er ein Gedicht von 800 Versen, das sich mit den erwähnten griechischen Gewohnheiten satirisch beschäftigte und über die Folgen des Weingenusses philosophierte. Daß sein Werk nicht länger war, ist allerdings ein mir fremder Zug, erklärt sich aber aus den damals bedeutend höheren Papierpreisen; im übrigen scheint mir die anacharsische Abstammung dadurch auch charakterologisch zweifellos erwiesen; das Gedicht war jedenfalls eine Art Bierzeitung. Ich könnte somit meine Selbstbiographie mit einer Besprechung der Küsten des Schwarzen Meeres und jener vorphilosophischen Zeit beginnen, welche durch die Namen der griechischen Weisen bezeichnet ist. Aber was würde dies nützen? Die Gründlichkeit verlangte, auf denUrsprung der Skythen zurückzugehen, die eigenen Vorfahren vor der Trennung der ersten Urvölker aufzusuchen und endlich jene Familie der Säugetiere zu entdecken, die zu meinen speziellen Stammesgenossen durch Auslese und Zuchtwahl sich zu entwickeln die Ehre hatte.
Und noch weiter! Sollte man nicht bestrebt und imstande sein, nicht bloß Gattungsmerkmale, sondern auch spezifisch individuelle Eigentümlichkeiten bereits im Häckelschen Stammbaum des Menschengeschlechts aufzusuchen? Ja es ist kein Zweifel, daß die Selbstbiographie nach historischer Methode mit einer Untersuchung über den Ursprung der Organismen überhaupt einsetzen müßte. Man könnte etwa so beginnen: »Die erste Kunde meines Geschlechts erhebt sich dort, wo in den Tiefen des Urmeeres der laurentischen Periode eine behäbige Amöbe auf den Gedanken kam, sich zu halbieren. Die dickere Hälfte wurde mein Urahn. Sie erfreute sich eines stattlichen Zellkerns in kräftiger Protoplasmamasse und setzte die Methode der Teilungen mit Erfolg fort. In meinem Geschlechte war es auch, wo zuerst die Sitte aufkam, daß die Tochterzellen nach derTeilung nicht ihre eigenen
Wege gingen, sondern zusammenblieben und sich gegenseitig unterstützten; damit geschah der unermeßlich wichtige erste Schritt zur Bildung von Zellgenossenschaften, von entwicklungsfähigen höheren Organismen. Seitdem blieb unserem Geschlechte eine dauernde Freude, Vereine zu gründen und im Kreise gleichgesinnter Genossen mit behaglicher Rede sich mitzuteilen.«
Aber wohin komme ich? Ich beginne persönlich zu werden und habe den Ursprung des Geschlechtes noch keineswegs gründlich erforscht. Denn jene Amöbe mit dem Zellkern stammte von einem kernlosen Moner und dieses Urprotoplasma—woher stammte dies? Wir stehen vor der Frage nach dem Ursprung des Lebens und sehen uns genötigt, die historische Methode unmittelbar in die metaphysische überzuführen.
III. DIE METAPHYSISCHE METHODE.
Ein philosophischer Freund machte mich auf eine Auffassung der Welt aufmerksam, welche viel für sich hat, und die ich daher hier zu erwähnen nicht unterlassen will; ich muß aber ausdrücklich bemerken, daß weder ich, noch mein Freund, sondern ein mir unbekannter Freund dieses Freundes die fragliche Entdeckung gemacht hat, daß ich auch nicht weiß, ob sie nicht vielleicht schon irgendwo veröffentlicht ist, und daß ich genauere Quellen nur darum nicht anführe, weil ich sie nicht ermitteln konnte. Nach dieser Ansicht ist nämlich die Welt nichts anderes als ein Schweizerkäse, und wir Menschen sind die Löcher darin. So wahrscheinlich diese Hypothese ist, so müßte ich sie, wie das unter Metaphysikern üblich ist, doch schon darum energisch bestreiten, weil ich sie nicht selbst aufgestellt habe. Aber ich bin imstande, die Richtigkeit derselben mit einer kleinen Änderung zu beweisen; ich behaupte nämlich, die Welt ist kein Schweizerkäse, sondern absoluter Käse schlechthin; und die Menschen sind keine Löcher, sondern die Menschheit ist das absolute Loch als solches schlechthin.
Schon in den uralten indischen Geheimvedas sagt der ehrwürdige Oberbrahmine Wischtanischtarumnubummarappaltasdaja:
»Wäre die Welt
Bodenlos
Auch nicht zerschellt
Als Käsekloß,
So wäre das Nicht
Immer doch
Am Himmel des Lichts
Ein großes Loch.«
Die Deutung ist klar. Die Welt ist Käse, aber sie ist zugleich—und das ist der Tiefsinn, welcher das ziemlich unästhetische Bild zur metaphysischen Wahrheit symbolisiert—die Welt, als Käsekloß, ist »bodenlos« und »zerschellt«; das bedeutet, die Welt als Materie, als roher, ungeformter Stoff (Kloß = Chaos), ist ohne Zusammenhang, ohne Grund und Ziel, ein bodenloses Trümmerwerk, zerschellt im absoluten Ozean des Seins. Aber wäre sie auch nicht unrettbar verloren, so würde schon der bloße Umstand, daß es ein »Nichts« giebt, ausreichen, um »ein großes Loch am Himmel des Lichts« zu konstatieren, d. h. ein unersetzliches, un ausfüllbares Defizit in der Rechnung, welche freundliche Erwartung auf die Welt setzt. Der indische Weise vermochte eben in dem »Nichts« nichts als das Negative zu sehen, ihm schließt sich das Sein als das rettungslose Nichts des Pessimismus und der Weltflucht. Anders wir! Indem wir das Nichts als Loch fassen, erkennen wir den Unterschied zwischen beiden. Das Loch ist das limitativ gedachte Nichts, es ist nicht das reine Nichts, sondern das Nichts, das die Grenze des Stoffes voraussetzt, in welchem es ein Loch ist. Und insofern ist es nicht nichts, sondern im Gegenteil alles, die Verbindung des Seienden, die formgebende und formbestimmende Bedingung der Gestaltung des Urstoffes. Der absolute Weltkäse als solcher wird durch das Loch als formsetzende Macht zur Weltgesetzlichkeit) zur objektiven Natur differenziert, während sich zugleich das absolute Loch als solches zur Vielheit der Löcher individualisiert. Diese formsetzende Macht aber ist die Menschheit, als die transcendentale Bedingung der Natur, als die grenzbestimmende Gewalt in dem Chaos des Gegebenen, und die individualisierten Löcher sind die einzelnen Menschen, jeder mit den anderen eine unerläßliche Gestaltungsbedingung des Weltkäses (Käse = Chaos), und doch für sich nur ein kleines Nichts, eine Höhlung im All, ein aufgeblasenes Loch in der Fülle des Seins. Welch erhabener Gedanke! Je mehr Löcher, umso weniger Käse! Also: je mehr Menschheit, um so weniger Welt, je mehr Geist, um so weniger Stoff—das eröffnet den hoffnungsreichen Prospekt in den Vergeistigungsprozeß des Daseins, die Unteru'erfung und Vernichtung der trägen Masse durch die sich entfaltende Kraft des Geistes, die Aufzehrung des Weltkäses durch das Loch.
Damit haben wir endlich festen Boden gefunden. Die Selbstbiographie eines gewissenhaften und gründlichen Autors muß beginnen mit der metaphysischen Position seines transcendentalen Ich, sie muß beginnen mit dem vorzeitlichen Moment, in welchem das noch raumlose Loch seiner Individualität in dem absoluten Käse seine erste absolute Setzung erfuhr. Machen wir uns dies ganz klar, indem wir das Gesagte kurz in populärer Sprache zusammenfassen: Indem die Negation durch die Limitation in die Realität übergeht, setzt die absolute Synthesis durch Schematisierung der Kategorien in der Sinnlichkeit die centralisierte Individualisation des Konkreten und beginnt damit die transcendentale Genesis des autonomen Individuums als empirischen Charakters zur biologischen Evolution, indem die fundamentale Bedingung autobiographischer Konzeption sich unbeschadet statistischer und historischer Impotenz in der begrifflichen Analyse des reinen Ich als absolute Lochheit erfüllt.
Sobald ich die Uberzeugung gewonnen habe, daß der gebildete Lesersich über die dargestellten, eigentlich selbstverständlichen Grundgedanken völlig klar geworden ist, werde ich die Einleitung in meine eigene Selbstbiographie nach der metaphysischen Methode diesen Prolegomenen folgen zu lassen in gründliche Erwägung ziehen.
Dacht' ich es doch, man werde den Platz, den stillen, mir
rauben
Den ich gestern am Hang unter der Linde gewählt.
Wie behaglich die Rast, wie kühl der dämmernde Schatten!
Und durchs liebliche Thal schweifte der träumende Blick
Über die Höhen hinaus ins Land; vom Glanze des Himmels
Zum erquickenden Grün kehrt er der Wiese zurück.
Also fliegt der Gedanke hinaus in unendliche Weiten,
Ein gefälliges Wort bindet ihn willig im Vers.
Hier am lauschigen Platz versprach die Muse zu weilen,
Wenn ich heiligen Sinns stiege den Hügel hinan.
Und die Gestalt im hellen Gewand und schützenden Hute,
Leicht an die Linde gelehnt, sollte die Muse mir seins
Ach, sie liest! Ihr Götter! So ärmlich nährt ihr die Seele
Mit erborgtem Geschwätz? Glüht nicht der Äther um euchs
Haucht nicht rings der harzige Tann ambrosische Düftes
Gaukeln die Falter euch nicht Tänze der Liebenden vors
Raunet der Wind nicht säuselnd um euch unsterbliche Lieder,
Und mit heiterem Mut prahlt der geschwätzige Bachs
Und sie liest! Und mußte darum der Stadt sie enteilens
Neckische Geister des Walds, scheuchet die Fremde mir auf!
Tummle dich um das verschlossene Ohr, hellsummende Fliege,
Laß vor den Augen dich ihr, spinnende Raupe, herab!
Und du, rauschender Wind, ergreife die Blätter des Buches,
Unter der zierlichen Hand hauche die Zeilen hinweg!—
Mürrisch schreit' ich vorbei, den Blick zu Boden geheftet,
Und doch hat er den Text, hat er die Finger gestreist.
Prosa!—Rascher beschwing' ich den Schritt im einsamen Waldweg;
Unmut steigt mir empor über die lesende Welt,
Über die schreibende mehr noch zürn' ich. Allen Autoren
Gilt mein kräftiger Fluch, und den Verlegern dazu!
Wären es Verse, vielleicht, ich ließe die Leserin gelten;
Aber ein flacher Roman, aber ein langer Essay!
Und da sitzt sie im Walde, den Blick im Buche vergraben,
Gleich als wäre das Thal ihr das bekannte Gemach,
Das sie zum hundertsten Male mit offenem Mündchen begähnte;
Nur mit der hölzernen Bank ward ihr das Sofa getauscht.
Aber ihr schweigt die weite Natur; papierene Weisheit
Macht sich laut, und das Wort hat die Empfindung betäubt.
Sucht nur im Spiegel des Buchs lebendiger Götter Gestalten!
Sehet, ein ganzer Olymp stellt photographisch sich ein.
Hermes darf euch gefallen und klug erscheinen Athene,
Wenn der Archäolog euch die Symbole benennt.
Glückliches Volk! Es schreibt populär der stolze Gelehrte,
Selbst die härteste Nuß knackt er behaglich euch auf.
Was verschwiegene Priester in heiligen Schriften begruben,
In verständlichem Deutsch lullt es geschwätzig euch ein.
Welch unwirtliches Land verschmachtende Forscher durchirrten,
Illustriert vergnügt's euch nach gelungenem Mahl.
Nicht zu den Sternen blickt mir empor! Ein billiger Atlas
Weiset die Namen und zeigt sichtlich bequemer das All.
Euch erzählt manch schreibender Arzt von zuckenden Muskeln,
Wie die Zelle sich teilt, malt der Botaniker auf,
Selbst die Gesetze des Raums versucht euch höflich zu modeln,
Wer Euklidischen Ernst nicht mehr für passend befand.
Irr' ich nicht, so bereitet man schon zur Schülerlektüre
Kants Kritik der Vernunft leicht und verständlicher vor.
Paraphrasen beherrschen den Markt. Selbst denke mir keiner!
Erst aus vermittelnder Hand wählt sich der Leser den Stoff.
Wie ihr druckt, so schreibt ihr mit Dampf! Und haben die Federn
Nicht unmündig genug endlich den Leser gemachts
Ach, es glaubt euch jeglicher Mann und jegliches Weiblein;
Was die Revne gebracht, reden sie selber sich ein.
Herrliche Weisheit tagt im Gespräch. Die Werke der Meister
Liegen verstaubt. Man liest über sie besser und mehr.
Und dann sitzt das kluge Geschöpf studierend im Walde;
Wie die Natur es ergreift, will es aus Büchern ersehn.—
Hat der verschlungene Weg mich genarrt? Hier bin ich am Anfang,
Zwischen den Bäumen hindurch schimmert mir wieder die Bank.
Immer noch weilt die Lesende dort. Doch—täuscht mich das Auges
Auf die Schulter geneigt hält sie das Köpfchen und ruht,
Nachzudenken vielleicht? Darf ich die Sinnende störens
Oder——Himmel! Sie schläft! Friedlich entglitt ihr das
Buch,
Und du siegtest, Natur! Den Autor zwangst du zu Boden,
Und die Frevlerin selbst hüllst du in strafende Nacht.
Dank sei dir! Du rächtest auch mich. Still schleich' ich vorüber—
Nur den Titel—? Es ist—Götter!—mein eigenes
Werk!